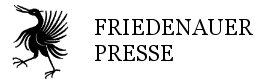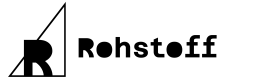zur Publikation vorgesehen in »Romanische Studien« (2018), ein Vorabdruck.
Éric Vuillards Bücher sind Geschichtsfiktionen. Ihr Genre, im Französischen schlicht récit genannt, ist hierzulande, wo man stets um genaue Einordnung bemüht ist, schwer zu fassen: Roman, Erzählung, Essay, Kurzprosa, Geschichtsroman, Dokufiktion[1] oder sogar Rhapsodie wie bei Vuillards erstem Buch in Deutschland, Ballade vom Abendland (2014), um dem epischen Atem, der musikalischen Behandlung der Sprache gerecht zu werden?
Leichte Verunsicherung aber auch jenseits des Rheins, dass Vuillard ausgerechnet mit einem essayistisch inspirierten Genre den Prix Goncourt gewann[2]. Auf jeden Fall eine Form der historischen Anverwandlung, die den Nerv der Zeit trifft und dem Bedürfnis nach einer auch politisch engagierten Beleuchtung der von einem neuerlichen Rechtsruck heimgesuchten Kontinente entspricht. Auch Olivier Guez fiktionalisiert in seinem Roman La Disparition de Josef Mengele (2017)[3] ein Thema der deutschen Zeitgeschichte und ist dafür mit dem Prix Renaudot ausgezeichnet worden. Ein Roman, der im Anhang die gewählte Form begründet und die zugrunde gelegte Sekundärliteratur aufführt, im Text selbst aber seinen Figuren immer wieder fiktive Zitate in den Mund legt. Vuillard verfährt bei seiner Fiktionalisierung ungleich radikaler und im Grunde genau umgekehrt wie Guez: keine Quellenangaben, dafür im Text nur gesicherte, wenn auch nicht ausdrücklich gekennzeichnete Zitate aus den Nürnberger Prozessakten oder Kurt Schuschniggs Memoiren. Sein Anspruch auf Literarizität ist absolut: Noch die kürzeste Quellenangabe würde die in sich geschlossene Form des Textes aufbrechen. Der Autor ist kategorisch und hängt seine Fiktion mit bissiger Verve am Gerüst historischer Momentaufnahmen auf. Seine Fiktionalisierung der Geschichte besteht nach eigenem Bekunden in der subjektiven Zusammenstellung historischer Fakten[4], den frei etablierten Querbezügen, also in der Struktur seiner Bücher und ihrer raffinierten Montagetechnik.
In Traurigkeit der Erde (2014, dt. 2017) überblendet Vuillard die letzten Indianerkriege in den Vereinigten Staaten mit der Entstehung des Massenspektakels. Dabei thematisiert er das prekäre Verhältnis zwischen Geschichte und Fiktion gleichsam als Buch im Buch, wenn er beschreibt, wie Buffalo Bill, Erfinder der Wild West Show und großer Inszenierungskünstler, Überlebende der Indianermassaker auf die Bühne zerrt, um ihr eigenes Schicksal nachzuspielen: Ausdrücklich versorgt die Geschichte hier die Fiktion mit Menschenmaterial. In Kongo (2012, dt. 2015) collagiert der Autor die Mächtigen, die 1884 im Berliner Palais Radziwill über das Schicksal Afrikas entscheiden, mit apokalyptischen Szenen aus dem gebeutelten Kongo. Das Verfahren wird poetologisch unmissverständlich erläutert:
Wenn ich neben diese Geografen im Sonntagsstaat einen Kongoneger setzen will, wenn ich auf die Sitzbank in der Kutsche einen Korb stellen und in diesen Korb ein paar jener abgeschlagenen kleinen Hände legen will, die ich auf den anrührendsten Fotografien der Welt gesehen habe, wer kann mich daran hindern?[5]
In seinem Weltkriegspoem Ballade vom Abendland (2012, dt. 2014) findet die beim unheilvollen Attentat von Sarajevo abgefeuerte Revolverkugel am Buchende ein Pendant in der Munition, die den Banker und »großen Kriegslieferanten«[6] John Pierpont Morgan und den amerikanischen Präsidenten McKinley zur Strecke bringt. Die Flugbahn der Geschosse, die Vuillard hier zwischen den einzelnen Episoden ins Visier nimmt, berechnet sich in »Geld und Blut«[7].
In Die Tagesordnung entfaltet Vuillard seine Montagetechnik gleich mit dem eingangs aufgezogenen Theatervorhang. »Der Inspizient hat dreimal mit dem Stab geklopft«[8], so heißt es im Text, bevor sich der Vorhang auf die politische Bühne öffnet und der Zuschauer-Leser vor einem beklemmenden winterlichen Tableau des Vorkriegsberlin sitzt. Dann ein rascher Wechsel: Der Regisseur lässt die Drehbühne auf offener Szene umschwingen – »Die Literatur erlaubt alles« (9) – und konfrontiert den zuschauenden Leser plötzlich mit der Hinterbühne. Dort geschieht, was ihm die Historie eigentlich nicht unter die Augen und zu Ohren kommen lassen will, dort lassen die Mächtigen ihre Masken fallen, drohen, schüchtern ein, bluffen, setzen unter Druck und treffen geheime Absprachen, bevor der Hebel wieder umgelegt wird und sie sich zum offiziellen Händedruck auf der Vorderbühne zeigen.
Das der Literatur vorbehaltene Umschwingen findet in Vuillards Texten auch im Kleinen statt. Seine temporeichen Sätze preschen permanent vor, er schreibt zugleich atemlos und in einem Atemzug, der die Dringlichkeit seines Anliegens abbildet. Vuillards Sprache zeichnet sich durch ständige Registerwechsel aus, die so fein orchestriert sind, dass es ein Vergnügen ist, sie in der Übersetzung nachzubilden. Vom lyrischen Duktus des Romananfangs mit einem uns im Deutschen eher unbehaglichen Pathos wechselt er zu schärfster Ironie, sobald er die 24 Ältesten keuchend durch das Treppenhaus des Reichstagspräsidentenpalais jagt. Die wohlaustarierte Mischung aus lapidaren Kurzsätzen und komplizierten Langsatzkonstruktionen strebt fast immer auf eine besonders pointierte Aussage am Kapitelende zu. Wie spitze Pfeile werden die einzelnen Sätze abgeschossen und zielen dem Leser ins Mark. Als Übersetzerin ist man stets gehalten, die Sätze so zu drehen, dass die Betonung auch im Deutschen auf das bedeutungstragende Wort fällt: »Reglos verharren sie dort, wie vierundzwanzig Rechenmaschinen an den Toren zur Hölle« (20), schließt etwa das zweite Kapitel Die Masken. Oder der sich endlos dehnende Abschiedslunch in der Downing Street mit dem unbändig quasselnden Ribbentrop, eine Episode, die vor barock-burlesken Exkursen nur so strotzt und mit einem schlichten Geschichtsbuchsatz endet: »Die deutschen Truppen waren soeben in Österreich einmarschiert« (75). Während Ribbentrop wortreich auf der Vorderbühne tänzelt, wird im Kulissenbereich der militärische Einmarsch vorbereitet, den wir als Leser – genau wie die damaligen Zeitzeugen – gänzlich verpasst zu haben scheinen. Mit dem dokumentarischen letzten Satz jedoch schwingt die Drehbühne jäh wieder um, und wir schauen erneut hinter die Kulissen: Blitzkrieg, das nächste Kapitel und im Übrigen „ein Wort, das die Werbung dem Fiasko angehängt hat“ (82), scheint uns Aufklärung zu versprechen, lässt uns vorerst aber nur zusammen mit den schamlos erwartungsfrohen Österreichern auf die leere Bühne starren, bevor Ein Panzerstau das wahre Chaos auf der Hinterbühne offenbart.
Als Übersetzerin ist man zugleich Regieassistentin, Masken- und Kostümbildnerin, ja nicht zuletzt Tontechnikerin. Man muss die Inszenierung verinnerlicht haben – nach mittlerweile vier Vuillard-Übersetzungen sind bestimmte Muster wiedererkennbar – und nach Möglichkeit die »richtigen« Entscheidungen treffen, um das Geschehen auf der Bühne angemessen zu unterstützen. Zu diesen Entscheidungen gehört der bereits erwähnte achtsame Umgang mit der pfeilartig niederprasselnden Syntax, aber auch der Wille, bewusste stilistische Brüche nachzubilden – etwa, wenn einer der »ehrwürdigen Patrizier« (8) sich »andächtig in seinen Rotzlappen« (15) schnäuzt und sich die versammelten Industriellen »ein bisschen groggy« den »Rauch ihrer Lötkolben« (14) in die Augen steigen lassen – oder semantisch an die Epoche der »Vatermörder«, »Backfische« und »Wagenschläge« zu erinnern. Es gilt, der immer wieder verfremdend das Geschehen unterbrechenden Stimme des Regisseurs Raum und seinen stark stilisierten belehrenden Einwürfen, die gerne mit großen Zeitsprüngen in die Antike zurückverweisen, das entsprechende Relief zu verleihen. Die Stimmtypen und Rollencharaktere in Die Tagesordnung ergeben sich wie von selbst aus den Repliken der historischen Protagonisten, die im Originalton eingespielt werden. So himmelschreiend banal wie Görings und Ribbentrops Telefongeplänkel, so harsch wie Hitlers Berghoftiraden vermöchte keine Fiktion zu sein. Der charakteristische Ton, den der Erzähler Vuillard in seinem Lehrstück anschlägt, verlangt nach gezielten akustischen Effekten. Die lautliche Qualität dieser Prosa ist mit unbedingter Sorgfalt zu behandeln. Im Laufe unserer Zusammenarbeit der letzten Jahre ist es regelmäßig vorgekommen, dass ich den Autor lesen höre und je nach Hebungen und Senkungen seines Vortrags Satzzeicheneinträge in meinen Stimmenauszug notiere; umgekehrt aber auch, dass er mich einen Satz zu lesen bittet und dann, ohne des Deutschen mächtig zu sein, nach dem Gehör eine Präferenz äußert. Es ist eine Prosa, in der jedes Wort sitzen muss und in der es, wie in der Lyrik, kein Wort zu viel geben sollte.
Regieassistenz und Tontechnik, gewiss. Aber als Übersetzerin sitzt man wie alle anderen Leser auch immer wieder im Zuschauerraum und wird zur mitwissenden Zeugin der Dreh- und Simultanbühneneffekte. Für jemanden, der nicht nur zwischen Regisseur und Publikum vermittelt, sondern jenseits des Bühnenraums auch zwischen den Kulturen, ist Die Tagesordnung kein Buch wie alle anderen. Schließlich geht es um das schmerzlichste Kapitel der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Im Gegensatz zu uns Rezipienten ist derjenige, der die Fäden der Inszenierung in der Hand hält, Franzose. Und als solcher erstaunt darüber, wie neuralgisch das Thema hierzulande nach wie vor ist. Aus Sicht der Franzosen ohnehin ein merkwürdiges »hierzulande«, wo beliebte Minister wegen unredlich dokumentierter Doktorarbeiten den Hut nehmen müssen und nicht ausdrücklich gekennzeichnete Übernahmen als Plagiat gelten. Während deutsche Studenten das wissenschaftlich angemessene Arbeiten mit korrekter Zitierweise üben, ist in Frankreich die sogenannte »dissertation« die Königsdisziplin: In ihr werden, strukturiert durch eine formal ausgewogene und streng vorgegebene Gliederung, die verschiedenen Facetten einer Fragestellung aufgeführt und zu einer überzeugenden Schlussfolgerung gebracht. Dabei ist es erwünscht, sich exemplarisch auf Autoren und Werke zu berufen, nicht aber Usus, die angeführten Quellen zu belegen. Alle Übersetzer/innen aus dem Französischen kennen dieses kulturell bedingte Dilemma. Während der Arbeit zur deutschen Fassung von L’Ordre du jour haben wir darum gerungen, ob der deutschen Sensibilität zuliebe nicht wenigstens ein kurzer Hinweis auf den freien Umgang mit den Quellen im Buch erscheinen sollte; ähnliche Überlegungen, wie sie auch die Entstehung der Guez-Übersetzung begleiteten. Die Antwort gibt das Buch nun selbst, indem an seine Form nicht gerührt worden ist. Das ist aus literarischen Erwägungen gut so und hat, wie die ersten Rezensionen zeigen, jenseits der Buchdeckel sogar eine befreiende Wirkung: ein »unkonventionelles« Buch, das eine altbekannte Geschichte »noch einmal ganz frisch und nahegehend erzählt«[9]; Christoph Vormweg lobt den Ansatz, »der in keine Schublade passt«, als »höchst eigenwillig«[10], und Volker Weidermann schreibt im Spiegel, in ihren großen Momenten könne Literatur »blitzhafte Verwandlung träger, alter, viel zu oft erzählter Geschichte in schockierende Neuigkeit bewirken«[11].
Als (deutsche) Zuschauer des Vuillard’schen Bühnenspiels sind wir gegenüber den Hauptakteuren der Handlung hochgradig voreingenommen und per se zu einer kritischen Betrachtung geneigt. Wir kennen den Ausgang, und vor allem: Wir wissen um das ganze Ausmaß des Grauens, das uns weder auf der Vorder- noch auf der Hinterbühne vorgeführt wird. Das Schlimmste, Ausgesparte spielt sich in der Versenkung ab. Vuillards episches Theater verknüpft Einzelszenen und dokumentarisches Material zu einer kunstvollen Montage, deren Gang wir gespannt verfolgen und die uns immer wieder über den Weinenden lachen und über die Lachenden weinen lässt.
Dieser Text erschien zuerst auf blog.romanischestudien.de, dem Blog zur Zeitschrift Romanische Studien.
[1] Neben anderen einfallsreichen Einordnungsversuchen benutzte zum Beispiel Niklas Bender den der filmischen Dokumentation entlehnten Begriff der „Dokufiktion“ in seiner Besprechung von Traurigkeit der Erde, „Alles, was er anfasste, wurde zu Pappmaché“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. September 2017, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/eric-vuillards-geschichte-von-buffalo-bill-cody-15204757.html. Dabei muss man davon ausgehen – ein Blick in die Kundenrezensionen von Online-Buchhandlungen bestätigt es –, dass der „durchschnittliche“ Leser schon eher um eine Antwort verlegen ist und die ungewöhnliche Form aufgrund der Thematik meist als „Sachbuch“ rezipiert.
[2] Vgl. zum Beispiel Emmanuèle Lavinas, „Éric Vuillard, un homme précis“, Libération, 1. September 2017, http://next.liberation.fr/livres/2017/09/01/eric-vuillard-un-homme-precis_1593587 oder den Kommentar der Goncourt-Jurorin Françoise Chandenagor „La beauté du style, bien sûr, mais ce n‘est pas un roman…“, L’Express, 6. November 2017, https://www.lexpress.fr/culture/livre/eric-vuillard-un-goncourt-consensuel-ou-presque_1958172.html.
[3] Olivier Guez’ Buch erscheint im August 2018 auf Deutsch: Das Verschwinden des Josef Mengele, übers. von Nicola Denis (Berlin: Aufbau Verlag, 2018). Vgl. dazu Kai Nonnenmacher, „Mengeles Verschwinden: Olivier Guez an der Schwelle der Zeitzeugenschaft“, in Diversität und Engagement: für Frank-Rutger Hausmann zum 75. Geburtstag, hrsg. von Wolfgang Asholt, Ursula Bähler, Bernhard Hurch, Henning Krauß und Kai Nonnenmacher, Romanische Studien: Beihefte 4 (München: AVM, 2018), 383–97.
[4] Vgl. z. B. das Interview mit Éric Vuillard, „Ce qu’on appelle fiction participe à la structure de notre savoir“, L’Humanité, 5. Mai 2017, https://www.humanite.fr/eric-vuillard-ce-quon-appelle-fiction-participe-la-structure-de-notre-savoir-635678.
[5] Éric Vuillard: Kongo, übers. von Nicola Denis (Berlin: Matthes & Seitz, 2015), 82.
[6] Éric Vuillard, Ballade vom Abendland, übers. von Nicola Denis (Berlin: Matthes & Seitz, 2014), 165.
[7] Vuillard, Ballade vom Abendland, 165.
[8] Vuillard, Die Tagesordnung, 7. Alle folgenden Zitate aus Die Tagesordnung stehen mit dem entsprechenden Seitenverweis direkt im Text.
[9] Dirk Fuhrig, „Eine kurze Geschichte der Nazi-Diktatur“, Deutschlandfunk Kultur, 31. März 2018, http://www.deutschlandfunkkultur.de/eric-vuillard-die-tagesordnung-ein-kurze-geschichte-der.950.de.html?dram:article_id=414439.
[10] Christoph Vormweg, „Was Hitler stark machte“, Deutschlandfunk, Büchermarkt, 29. März 2018, http://www.deutschlandfunk.de/eric-vuillard-die-tagesordnung-was-hitler-stark-machte.700.de.html?dram:article_id=414296.
[11] Volker Weidermann, „24 Echsen wollen Krieg“, Der Spiegel, 24. März 2018, 125.