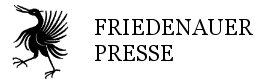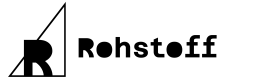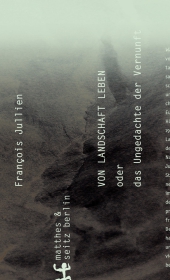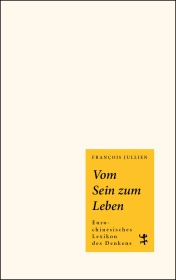Gegenwärtig befindet sich die Welt in einem Zustand der sanitären Krise. Nachdem »Krise« so oft auf dem Gebiet der Wirtschaft und Finanzen verwendet wurde, trifft uns nun dieses Wort mitten in unserem Leben. Was ist nun, Ihrer Meinung nach, eine »Krise«?
Der griechischen Herkunft nach ist die Krise das, was »scheidet«. Es ist der kritische und dramatische Moment, der zwischen den entgegengesetzten Möglichkeiten entscheidet. In der Medizin zwischen Tod und Leben. Im Theater vor dem finalen Akt, wenn die durch die Handlung hervorgerufene Spannung ihren Höhepunkt erreicht. Nun möchte ich auf Grundlage einer anderen Sprach- und Denktradition, und zwar der chinesischen, eine andere Herangehensweise an »Krise« vorschlagen. Im Chinesischen heißt Krise wei-ji: »Gefahr-Gelegenheit« – heutzutage im Managementmilieu ein gängiger Ausdruck. Der Krise nähert man sich als einer Zeit der Gefahr, zugleich kann man in ihr eine günstige Gelegenheit entdecken, die man zunächst übersehen kann; es gilt, diesen günstigen Aspekt herauszufinden, man muss sich nur genau damit befassen, damit er voll zur Entfaltung kommt. So wendet sich die Gefahr in ihr Gegenteil. Aus dem tragischen wird gewissermaßen dialektisch ein strategisches Konzept.
Dies wäre also der »gute Gebrauch« der gegenwärtigen Krise. Und wie wäre zunächst der persönliche und existentielle Gebrauch in dieser von Panik durchzogenen Misere?
Kollektiv müssen wir derzeit eine negative Situation durchqueren. Aber dies könnte- ja sollte sogar (als ethische und politische Aufgabe) – die Gelegenheit sein, neue, im wahrsten Sinne des Wortes »unerhörte«, noch gar nie erahnte Möglichkeiten zum Vorschein zu bringen. Hier geht es nicht um eine billige Moral des Trostes oder der Kompensierung, sondern um ein rigoroses Konzept des »wahren Lebens«. Denn unsere Leben hören im Lauf der Zeit nicht auf, zurückzustecken, zusammenzuschrumpfen und zu verkümmern: lassen ihre unerhörten Möglichkeiten unberührt. Sie resignieren und verfestigen sich in wiederholenden Abläufen, lassen sich entfremden und verdinglichen, werden zu Scheinleben, d. h. zu einem Leben, das nur den Anschein eines solchen gibt, zu einem Pseudo-Leben, das nicht wirklich lebt. Nun ist das wahre Leben gar kein ideales oder ein anderes Leben, sondern nur eines, das sich diesem verlorenen Leben widersetzt, das sich gegen diese lebensbedrohliche Resignation, diese Verfestigung, diese Entfremdung und Verdinglichung, dessen sich das Leben selbst gar nicht bewusst ist, auflehnt. Wie beginnt man nun, diesem Leben ein Nein entgegenzusetzen – einem Leben, das im Laufe der Zeit oder war es nicht schon seit jeher? – nur ein scheinbares war? Vielleicht ist es gerade die Gelegenheit der Krise, ihre »positive« Seite, die uns eine Stütze dafür bietet – in dieser Zurückgezogenheit, in der wir schonungslos vor uns selbst gestellt werden –, das gekünstelte Leben, das nur allzu rissig ist, aufzugeben und im wahren Leben Fuß zu fassen.
Nichtsdestoweniger sagt man heute sehr oft, dass nicht wenige Paare, eingesperrt wie sie nun mal sind und einige ohne Beschäftigung, so sehr unter der Krise leiden, dass eine Trennung droht …
Vielleicht findet man hier wieder die griechische, heilsame Bedeutung von »Krise«, die in dem, was nicht mehr zu ertragen ist, einschneidet. Zwei Personen, die sich miteinander bereits langweilten aber dies einander nicht zu sagen wagten, die es vielleicht gar nicht bemerkt hatten, die sich damit abgefunden hatten und gewohnt waren, einander zu ertragen, deren »Leben als Paar« sich also bis zu diesem Punkt damit abgefunden und verloren hat, sieht sich schließlich gezwungen, dazu Stellung zu nehmen und eine Wahl zu treffen. Vielleicht ist die Situation in der Tat bereits dermaßen mies, ihre »Unerträglichkeit« derart offensichtlich, dass sie in einer Trennung als einzigem Ausweg münden muss. Oder lässt sich in dieser Beziehung, die einzuschläfern drohte, durch diese gemeinsame Prüfung, diese erzwungene Gegenüberstellung ein neues Mögliches entdecken, und so könnten sie einander aufs Neue begegnen. Man wird dann von einem Leben »zu zweit« sprechen, wie man auch sagt (eine Last) zu zweit tragen. In dieser erzwungenen Eingeschlossenheit kann die unendliche Möglichkeit des Intimen entdeckt werden. Das Intime, das Madame de Rênal und Julien in dem Turm des Gefängnisses von Besançon endlich entdecken (Stendhal: Le Rouge et le Noir) …
Ist es das, was sie ein »zweites Leben« nennen?
Nun, tatsächlich kein neues Leben, denn es ist nicht einsichtig, durch welchen radikalen Schnitt, durch welches Wunder es hervorgebracht werden könnte, jedoch ein zweites Leben, das aus dem vorangegangenen Leben hervorgeht, aber davon abweichend, durch die überstandene Prüfung davon de-koinzidierend, sich davon lösen kann. Es gewinnt an Klarsicht: Die Klarsichtigkeit ist weder Intelligenz, noch Wissen, jedoch die Fähigkeit, Nutzen aus dem Negativen zu ziehen. Sie erlaubt, effektivere Entscheidungen für sein Leben zu treffen: Von dem , was im Leben nicht mehr zukunftsträchtig oder bereits erschöpft ist, abzulassen und in der Folge im Gegenteil dort sich eher zu engagieren, wo, nach genauer Prüfung des bisherigen Lebens, es nicht mehr illusorisch ist, aber ein wahres Leben eröffnet. Da ich bereits »gelebt« habe, bin daher endlich imstande, zu vergleichen und effektive Entscheidungen zu treffen. In der klassischen Epoche nannte man das »sein Leben reformieren«. Ich mag diese Formulierung Rousseaus im Hinblick darauf: »Ich beharrte darauf: Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich den Mut.« Denn man kann diesen Mut auch nicht haben, diese Möglichkeit, im Lauf des Lebens sich diskret vom bisherigen zu lösen, vorbeiziehen lassen und weiter ein Leben leben, das verkümmert, die Möglichkeit eines zweiten Lebens verpassen.
Aber dieses »Ausgangssperre«, diese erzwungene Eingeschlossenheit, der Verlust eines größeren Horizontes und der Freiheit. Sogar der elementarsten Freiheit, der Bewegungsfreiheit: nicht mehr an der vorgeschriebenen Leine gehalten zu werden, sich nicht weiter als 500 Meter von seinem Wohnsitz entfernen …
Aber sind wir nicht immer in einer gewissen Eingesperrtheit (confinement)? Sind wir nicht stets eingegrenzt – beschränkt – durch die uns umgebende Welt? Dem stellt sich, glaube ich, die Fähigkeit zu »existieren«, entgegen. Denn existieren heißt, sich »außerhalb zu halten«, so im Lateinischen. Während ich in der Welt, von ihr begrenzt, eingesperrt bleibe, kann ich mich außerhalb von ihr aufhalten, ihre Umzäunung überwinden. Insofern ist existierenethisch. Diese Tatsache macht es menschlich, noch vor jeglicher Moral: Das dem Menschen Eigene, was ihn zum Menschen gemacht hat, ist, dass er von den ihm verliehenen Eigenschaften und Bedingungen de-koinzidieren konnte und sich außerhalb der ihn beengenden Grenzen herumtreiben konnte. Nur deshalb ist es nur der Mensch, der »existiert«. Die Strenge des Eingesperrtseins könnte diese Forderung wieder lebendig werden lassen: durch sein Bewusstsein/Gewissen die physische Eingrenzung überwinden. Vielleicht finden Sie das ein wenig »metaphysisch«, aber Zeiten wie diese erinnern uns gerade an das, was sich in unserer Erfahrung an Metaphysischem abspielt, wenn man sich nicht von dem bloßen Anschein des Lebens erdrücken lässt.
Wie ist das nun im kollektiven Sinn? Es gibt auch die Welt, die geopolitischen Zwänge. Kann man in der Gefahr, die wir durchleben, auch eine günstige Gelegenheit ausfindig machen (wie das Chinesische so treffend im Wort »Krise« benennt)?
Die chinesische Regierung hat das auf ihre Weise bereits gemacht. Anfangs und ungefähr während zweier Monate, ist China unwillentlich tief in diese Gefahr versunken, ohne geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Und das aus ideologischer Leugnung: Da die Machthaber die Augen schlossen und die Wahrheit unterdrückten, hat China eine Epidemie zu einer Pandemie werden lassen, die vermieden hätte werden können. Das ist eine Tatsache und daher eine Verantwortung, zu der sich die chinesische Regierung bekennen und die sie übernehmen muss. Es stimmt aber auch, dass es dem autoritären Regime, das heutzutage China lenkt, gelang, dieses Negative zu seinem Vorteil zu wenden, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Innenpolitisch hat die Ausgangssperre, die es im Weiteren verhängen musste, dazu gedient, die Kontrolle über die Bevölkerung zu verschärfen, die Xi Jiping seit er an der Macht ist, methodisch (numerisch) zu implementieren trachtet: Im Namen der nationalen Einheit und der aus gutem Grund erforderlichen Solidarität hat das autoritäre Regime des Prinzen eine wertvolle Gelegenheit gefunden, noch unerbitterlicher zu werden. Jene, die eine so gut etablierte Ordnung, die der Epidemie Einhalt gebieten konnte, bewundern, sollten sich von den Propagandaslogans nicht täuschen lassen, die darauf aus sind, China als Beispiel den »debilen« Demokratien gegenüberzustellen. Außenpolitisch hat China der Welt die Pandemie zukommen lassen und wird, indem sie seine Wirtschaft wieder in Gang setzt, von unserer Schwächung profitieren. Es wird uns zu seinem Vorteil eine Lektion erteilen und Europa billig kaufen können.
Bin ich hier nicht zu kritisch?
Man muss sich vor zwei Dingen hüten: vor der Sinophobie ebenso wie vor der Sinophilie, zwei Klippen, denen vor allem Frankreich seit zwei Jahrhunderten nur schwer ausweichen kann: dem »chinesischen Katechismus« der Gelehrten oder »der gelben Gefahr«. Nun glaube ich, habe ich so sehr dazu beigetragen, die Ressourcen des chinesische Denken in Europa bekannt zu machen – sie auch dazu benutzt, die europäische Philosophie erneut zu befragen und ihr eigenes »Ungedachtes« aufzudecken-, um mir zu erlauben, das zu sagen, was man sehr wohl weiß, aber was man aus »realpolitischen« Gründen und wegen der Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen nicht zu sagen wagt … Denn man hat kein Recht, das zu ignorieren: die Unterdrückung der Uiguren – danken wir »Le Monde«, dass darüber berichtet wurde. Oder die Zensur, immer weniger diskret, der die Verlage und Universitäten unterworfen werden. Oder der Druck auf Taiwan, eine echte Demokratie, der es, obwohl von der WHO ausgeschlossen, ohne lautstarker Emphase gelungen ist, mit peinlichst genauer Effizienz die Gefahren der Epidemie einzudämmen.
Aber könnte nicht auch Europa von dieser Krise profitieren, sie zu ihrem Gunsten wenden?
Europa ist heute in einem kritischen und dramatischen Stadium – also im griechischen Sinn – der »Krise« angelangt. Denn die Idee von Europa, wie sie nach dem Krieg gedacht wurde und bis zum Ende des letzten Jahrhunderts unsere Geschichte geprägt hat – das Europa des Friedens und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit – ist zweifellos ans Ende gelangt. Die gegenwärtige Krise könnte sie endgültig zum Verschwinden bringen: Das nationalistisch panische Sich-Einigeln ist das erste offensichtliche Anzeichen von »Krisenzeiten«. Man kann also Europa nicht mehr als Slogan rufen oder als Allheimmittel bezeichnen, vielmehr muss man überlegen, von welchen Ressourcen ausgehend man von Neuem seine Notwendigkeit behaupten kann.
Europäische »Ressourcen«?
Ja, genau! Die Frage ist nicht die nach einer europäischen »Identität«, sondern eine nach den europäischen »Ressourcen«. Das ist die Debatte, die wir heutzutage eröffnen müssen, um von Neuem Europa zu mobilisieren: nicht, es zu definieren versuchen – christlich oder aufgeklärt? –, sondern fragen, was Europa »ausmacht«. So ist das Wort »ideal« zum Beispiel ein Wort, das sich in allen europäischen Sprachen wiederfindet und das solcherart eine theoretische Geographie umreißt. Nun, wer hat gesagt, dass diese Ressource des Idealen erschöpft ist und nicht mehr Träger einer gemeinsamen Geschichte sein kann? Oder die Vielfalt der Sprachen, sie ist in Europa eine Ressource, die Europa ausmacht. Ich verteidige nicht in chauvinistischer Weise das Französische, sondern die Übersetzung, die, wie man weiß, »die Sprache Europas« ist, im Gegensatz zu einem minderen Englisch, das zum Globish wurde …
Hat Europa noch eine Chance?
Wir sind eine Epoche neuer Reiche angelangt: das chinesische, amerikanische, russische, türkisch, indische. Europa ist im Rückzug und am Rand des Konkurses. Wenn es aber imstande ist, die nächsten Jahrzehnte zu überstehen ohne in Einzelteile zu zerfallen, wird es, wenn diese Reiche sich aufgerieben haben, seine geschichtsmächtige Initiative wieder finden – aber nicht mehr in Form eines Imperialismus. Ja, Europa kann in ein »zweites Leben« eintreten. Die tragische Schärfe der Krise zwingt uns heute, die Passivität hinter uns zu lassen.
Interview von Nicolas Truong, erschienen am 16.04.2020 in Le Monde.
Aus dem Französischen von Erwin Landrichter übersetzt.