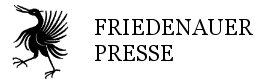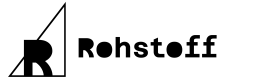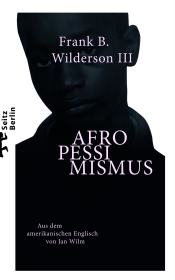Wie erklärt sich die brutale Alltäglichkeit der Gewalt gegen Schwarze Menschen? Warum bestimmt die Geschichte der Sklaverei ihre Erfahrungen bis heute? Wie kommt es, dass Rassismus jeden Aspekt des sozialen, politischen und geistigen Lebens berührt? Frank B. Wilderson III begegnet diesen Fragen in einer Weise, die so komplex ist wie unsere Verstrickungen in sie: Teils einschneidende Analyse, teils bewegendes Memoir, zeugt sein Buch davon, was es heißt, Schwarz – und das heißt für Wilderson immer zugleich, kein Mensch – zu sein.
Im Gespräch mit Matthes & Seitz Berlin geht er näher auf den Begriff Afropessimismus ein und gibt unter anderem Einblicke in die Einflüsse auf seine Theorie.
Matthes & Seitz Berlin: »Afropessimismus« ist ein sehr starker Begriff. Können Sie ganz allgemein erklären, was Sie darunter verstehen?
Frank B. Wilderson III: Es gibt Dinge, die Intellektuelle neu entdecken. Doch es gibt auch Dinge, die bereits existierten, aber von Intellektuellen in eine Form gebracht und dadurch erkennbar werden. Ich denke zum Beispiel an Sigmund Freuds Theorie des Unbewussten. Freud sagt sehr früh: Lange vor mir haben Menschen über das Unbewusste geschrieben – Dichterinnen und Dichter. Josef Breuer und ich haben die Ideen lediglich systematisiert. Afropessimismus ist eine Theorie zur Erklärung der Struktur des Schwarzen Leidens und der Symbiose zwischen Schwarzem Leiden und der Erschaffung von Welt.
So betrachtet, gab es diese Sichtweise schon im 7. Jahrhundert n.Chr. Menschen, die sich zuvor nicht als Schwarze bezeichnet hatten, wurden als Schwarze bezeichnet, während das Land, in dem sie lebten, den Namen Afrika bekam. Sie sahen dabei, dass die systematische Zerstörung ihrer Kosmologie, ihrer Familienbeziehungen, ihres Gemeinwesens in die Erschaffung von etwas anderem einfloss: nämlich, was es heißt, eine arabische Familie zu haben, eine arabische Ehe zu führen und so fort. An dem Ort, den wir heute Ostafrika nennen, gab es, wenn man so will, vor 1300 Jahren schon Afropessimisten.
MSB: In welchem Verhältnis steht der Afropessimismus zu anderen Erklärungsversuchen, um die anhaltende Diskriminierung von Schwarzen Menschen und Gewalt gegen sie zu zu verstehen?
Wilderson: In den 1990er- und frühen 2000er-Jahren erkannten Leute wie Jared Sexton, Sora Han, Kihana Ross, Saidiya Hartman und ich, dass multiethnische Koalitionen nicht in der Lage sind, die wesentliche Natur Schwarzen Leidens zu erklären. Die Grundlage für unseren systematisierenden Blick bildeten Frantz Fanon, Orlando Patterson, Hortense Spillers, David Marriott und Sylvia Wynter. Daraus entstand etwas, das mit dem Marxismus und der Psychoanalyse um Erklärungskraft konkurriert. Der Afropessimismus sagt nicht, dass Marxismus und Psychoanalyse verworfen werden müssen, nur, dass ihre Erklärungsfähigkeiten begrenzt sind, wenn es darum geht, Schwarzes Leiden zu begreifen.
Damals arbeiteten wir gerade an unseren Dissertationen, studierten und unterrichteten an der University of California in Berkeley: ich, Jared und Zakkiyah Iman Jackson. Wir erkannten, dass die Schwarze Person im kollektiven Unbewussten einen ganz anderen Stellenwert besitzt als Latinx-Personen oder Native Americans. Was ihr fehlt, ist eine Vermittlungsinstanz. Diese Vermittlungsinstanz fehlt, weil das Unbewusste die Schwarze Imago, das Schwarze Bild, nicht in ein fühlendes Wesen übersetzen kann. Es gibt keine Vermittlungsinstanz zwischen Sklaven und Herren, wie Orlando Patterson in Slavery and Social Death schreibt. Die Schwarze Person wird also nicht als ein Wesen mit einer eigenen Perspektive, mit einer Agenda, mit Ideen angesehen. Mit anderen Worten, wenn jemand meint: »Ich sehe alle als Personen an«, »Alle Menschen haben Ideen«, »Wir sitzen alle im selben Boot«, dann wird das im Unbewussten stark angefochten, denn das Unbewusste sagt, dass die Schwarze Person eigentlich nicht mehr oder nicht weniger ist als eine Erweiterung der eigenen Vorrechte.
MSB: Sie lebten Anfang der 1990er-Jahre in Südafrika. Hat die Zeit dort ihr Denken des Afropessimismus beeinflusst?
Wilderson: Ja. Ich kam aus Südafrika zurück in die USA, nachdem ich dort im African National Congress aktiv gewesen war. Jedes Mal, wenn jemand aus dem Untergrund eine Aktion gegen die Apartheid-Regierung plante oder wenn wir eine Propaganda-Initiative starten wollten, fragten wir uns: Wie verschärft das den Konflikt? Damals dachten wir, dass der Antagonismus ein Kampf zwischen den Besitzenden und den Habenichtsen sei. Als ich in die USA zurückkam, ging ich nach Berkeley zurück, wo ich in den 1970er-Jahren während eines Sabbatjahrs meines Vaters schon einmal gelebt hatte. Zurück in den Staaten stellte ich fest, dass diese Frage selbst in den radikalsten aktivistischen Gruppen nicht gestellt wurde. Es herrschte eine völlig andere Situation als in den späten 1960er- und 1970er-Jahren, als ich politisiert wurde und politische Radikalität kennenlernte. In den 1990er-Jahren lautete die Kernfrage, wie wir die Ressourcen der Zivilgesellschaft erweitern könnten, um mehr Leute an ihr teilhaben zu lassen. Ich dachte mir: Verdammte Scheiße! Nein, wir sollten die Zivilgesellschaft doch zerstören. Wie konnte das zur Grundlage radikalen Organisierens werden? Es war, als lebte ich in zwei verschiedenen Universen. Ich kam gerade aus Südafrika, wo die Frage lautete: Wie zerstört man den Staat? Und hier stellten die radikalsten Leute Fragen über Immigrations- und Gefängnisreform, was in sich konservative Konzepte sind.
MSB: Gab es einen konkreten Auslöser für die Ausformulierung des Afropessimismus zu diesem Zeitpunkt in den 1990er-Jahren?
Wilderson: Damals nahm ich an einer Lesegruppe teil, die Jared Sexton initiiert hatte. Ich war von Antonio Negris Marxismus beeinflusst, und Jared war damals noch ein Lacanianer. Wir diskutierten miteinander und besuchten Seminare über Antonio Gramsci und Jacques Lacan und Freud. Aber wir waren auch aktivistisch tätig und dachten: Irgendetwas fehlt. Ich schimpfte immer wieder über andere Teilnehmer:innen der Lesegruppe, weil sie so besessen waren von Konzepten wie Hybridität und Partizipation und von der Transformation des Staates. In der Lesegruppe sagte ich immer wieder: Strukturell ist das völlig falsch. Es ist ausgeschlossen, dass wir, die radikalsten Elemente der Gesellschaft, uns die USA als etwas Transformatives oder Ethisches vorstellen sollten. Jared griff dies auf und sagte: Was wäre, wenn wir den wesentlichen Antagonismus durch die Linse der Anti-Blackness, durch eine fundamentale Feindseligkeit gegen Schwarze, denken würden? Diese Frage weckte mein Interesse.
MSB: Wie kamen Sie auf den Begriff Afropessimismus?
Wilderson: Zur selben Zeit lasen wir eben Pattersons Slavery and Social Death. Was Patterson sagte, war: Wir sollten die Sklaverei so denken, wie Marx den Kapitalismus denkt, das heißt: nicht in der sehr empirischen angloamerikanischen Tradition, sondern auf eine abstraktere Weise. Dann muss unsere Frage lauten: Was bedeutet die Sklaverei als eine relationale Dynamik, nicht als eine gelebte Erfahrung? Jared empfahl mir außerdem, David Marriott zu lesen, da Marriot unserem Anliegen in ganz neuer Hinsicht auf der Spur sei. Ich las also David Marriots On Black Men und hatte prompt einen Nervenzusammenbruch, was ich am Anfang von Afropessimismus beschreibe. Damals sollte ich für die Zeitschrift Qui parle Saidiya Hartman interviewen, die auch in Berkeley forschte. Als ich sie schließlich traf, warf sie das Wort »Afropessimismus« in unser Gespräch ein. In den 1980er-Jahren war das Wort ein soziologischer und journalistischer Begriff der sogenannten »area studies«. In dem Feld waren Forschende der Meinung, dass sich Afrika niemals weiterentwickeln würde. Wir eigneten uns den Begriff an und machten daraus ein theoretisches Konzept.
MSB: Ihre Konzeption des Afropessimismus ist stark von der Semiotik, von der Zeichentheorie beeinflusst. Welche Bedeutung hat das für Ihre Theorie?
Wilderson: Ich möchte hier noch einmal auf Patterson zurückkommen: Ich glaube nicht, dass Differenz eliminiert werden kann oder dass sie an sich ein Problem darstellt. Ich folge Saussure und Peirce und Lacan, die sagen, dass Worte keinen organischen Wert besitzen können, dass keine indexikalische Linie vom Wort zum Ding führt. Damit es aber eine Konstellation von Wörtern und Begriffen gibt, die endlos wandelbar sind, muss es einen Begriff, ein Wort geben, das nicht wandelbar ist, das nicht vertauscht und mit neuer Bedeutung versehen werden kann. Und das ist das N-Wort. Das ist das Schwarze. Patterson hat dies dargelegt, als er meinte, dass es eine Entität, ein Ding oder ein Element, geben muss, das nicht in die symbolische Ordnung als transformatives Wesen eintreten kann, damit andere Wesen wissen, was die Fähigkeit zur Transformation überhaupt ist.
MSB: Was ist die Rolle des Pessimismus im Afropessimismus? Betrachtet man das alles nicht allein aus einer theoretischen Perspektive, dann klingt, was Sie sagen, sehr düster. Man könnte meinen, es fehlte nicht nur die Vermittlungsinstanz, sondern auch jede Möglichkeit, einen Weg aus dieser Sackgasse zu finden, richtig?
Wilderson: (Lacht) Es kommt darauf an, wer man ist. Ich meine, wenn man in West Oakland lebt, ist die Lösung, alles niederzubrennen. In Washington, D.C. klingt das vielleicht ein bisschen zu radikal. Aber Sie haben absolut Recht. Wissen Sie, ich habe Gramsci und Negri und Marx studiert und sie den Kommunist:innen in Südafrika nähergebracht, also kann ich das nicht alles einfach hinter mir lassen. Doch wir begriffen, dass Marx und bis zu einem gewissen Grad auch Lacan das Wort »Antagonismus« eigentlich falsch besetzt haben. Denn ein Antagonismus ist ein Kampf zwischen zwei Entitäten, für den es keinen begrifflichen Ausweg gibt. Zugleich bauen wir auf Gramsci auf, der sagt: »Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens.« Das ist ein Schlüsselsatz aus Gramscis Gefängnisheften, und was wir damit meinen, wenn wir das bei Gramsci entlehnen, ist, dass wir nicht pessimistisch sind, was die Fähigkeit der Schwarzen zum Kampf betrifft, oder dass alle Schwarzen niedergeschlagen sind oder so etwas. Nein, wir sind pessimistisch, was die Fähigkeit der Psychoanalyse und des Marxismus betrifft, das Leiden der Schwarzen vollständig zu erklären. Es ist ein Pessimismus der geistigen Arbeit.
MSB: Können Sie skizzieren, was in pragmatischer Hinsicht daraus folgt? Haben Sie persönlich Hoffnung, dass vielleicht die neue Regierung oder irgendeine zukünftige Regierung einen Wandel bewirken könnte oder dass die Black-Lives-Matter-Bewegung zu einem Wandel führen könnte, den wir bisher noch nicht kennen?
Wilderson: Nun – nein. Oder besser: Verschiedene Jas und Neins. (Lacht) Ich bin ein fanatischer Antiamerikaner. Ich habe seit Jimmy Carter nicht mehr gewählt. Damit aber Ihre Leser:innen nicht denken, ich sei allzu schlicht: Natürlich atme ich heute freier als noch vor zwölf Monaten, weil Trump weg ist. Doch bedeutet das, dass ich glaube, das kollektive Unbewusste Nordamerikas wird Schwarze ins Gemeinwesen der Staatsbürger:innen eingliedern, und sei es auf eine degradierte, erniedrigte Weise, wie es mit Native Americans und Menschen lateinamerikanischer Herkunft der Fall ist? Nein, ich glaube, das ist nicht möglich. Was ich aber glaube, ist, dass es durch genug Aufruhr in den Straßen, genug brennende Polizeistationen, genug Mobilisierungen, genug Leid unter weißen Progressiven dazu kommen kann, dass kosmetische Veränderungen geschehen. Mir als Schwarzer der Mittelklasse kommen diese kosmetischen Veränderungen zugute.
MSB: Das heißt, es gibt für den Afropessimismus keinen Übergang von der Theorie in eine wie auch immer geartete Praxis?
Wilderson: Sagen wir so, ich bin durchaus hoffnungsvoll, wenn ich sehe, wie der Afropessimismus in das radikale Denken von Schwarzen auf der ganzen Welt eingegangen ist. Vor Jahren habe ich Afropessimismus-Workshops in Wien, Berlin, Bremen und London veranstaltet. Das habe ich nie für möglich gehalten. Der Afropessimismus ist – als Thema – auch im Mainstream angekommen. Aber er ist etwas, womit sich Schwarze Gruppierungen in den letzten zehn Jahren beschäftigt haben, und natürlich ist Veränderung möglich. Doch der Knackpunkt bleibt, was Orlando Patterson sagt: Wenn man ein Wort wie »Freiheit« verwendet und wenn sich dieses Wort in der kollektiven Denkweise einer Gesellschaft manifestiert hat, dann muss es irgendwo eine versklavte Person geben, die nicht frei ist. Denn in semiotischer Hinsicht kann das Konzept der Freiheit keinen begrifflichen Wert besitzen, wenn es nicht irgendein empfindendes Wesen gibt, das keinen Zugang zu dem hat, was man mit »Freiheit« bezeichnet – ganz gleich, ob dieses Wesen nun in imaginären oder realen Ketten liegt. Der Punkt von Patterson in Slavery and Social Death ist, dass Sklaverei ein integraler Bestandteil aller stratifizierter, also aller geschichteten Gesellschaften ist, und das seit Tausenden von Jahren. Es muss ein fühlendes Wesen existieren, das keinen Zugang zu Zustimmung, zu Eigentum hat, wenn diese Dinge einen Sinn ergeben sollen. Patterson sagt, dies gelte für alle stratifizierten Gesellschaften. Ich bin also selbst nicht sehr hoffnungsvoll, aber hierin könnte Hoffnung liegen.
Differenz, um darauf noch einmal zurückzukommen, ist zentral für die symbolische Ordnung. Es muss ein begriffliches Gegenüber existieren, damit ein Wort seine volle Kohärenz entfaltet. Doch muss das heißen, dass sich diese gegensätzlich bezeichneten und konstituierenden Entitäten beherrschen müssen, weil sie verschieden sind? Das ist eine offene Frage. Ich würde mit Patterson sagen: Ist die Gesellschaft zivilisiert, ist sie stratifiziert, dann muss das der Fall sein. Wir wissen von den historischen Bantu-Wanderungen, bei denen Millionen von Menschen von Westafrika nach Ostafrika und in den Süden wanderten – wir wissen, dass dieser Prozess nicht immer von Herrschaft geprägt war. In diesem Fall war es möglich, dass eine Gruppe von 10000 Wandernden in ein Dorf mit 1000 Menschen kam und sagte: »Wir werden Euch nicht kolonisieren. Sagt uns stattdessen: Wer sind Eure Götter? Wie betreibt Ihr Landwirtschaft? Wie organisiert Ihr Eure Familien? Lasst uns sehen, ob unsere Konzepte miteinander vereinbar sind.« Allerdings waren dies eben keine stark stratifizierten Gesellschaften. Die Frage bleibt also: Muss Differenz zwangsläufig zu Herrschaft führen? Nicht unbedingt, aber es tut mir leid, wenn ich mit Marx sagen muss: So wie er annahm, dass die Welt irgendwann vollständig kapitalistisch sein würde, glaube ich, die Welt ist heute, als moderne Welt, vollständig gesättigt mit Anti-Blackness.
MSB: Wie verhalten sich Afropessimismus und Black Lives Matter zueinander? Auch in Deutschland sind Black Lives Matter, das Movement for Black Lives und die großen Demonstrationen im Anschluss an Polizeiübergriffe und -morde an Schwarzen Personen in den letzten Jahren ein Anstoß gewesen, um weiter zu ergründen und darüber zu diskutieren, welche Formen von Rassismus, welche Art von Anti-Blackness in Deutschland existieren und wie sie wirken.
Wilderson: Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich will knapp antworten, ohne allzu sehr zu vereinfachen. Bei dem Workshop, den ich in Wien organisiert habe und von dem ich bereits sprach, sagte ich: »Unser Workshop heute dauert bloß drei oder sechs Stunden. Er wird Euch nicht dabei helfen, in die Community zu gehen, um spezifische Reformen einzufordern. Er wird Euch jedoch helfen, die Grenzen Eurer Forderungen und die Struktur Schwarzen Leidens zu verstehen.«
Es ist unmöglich, sich um den Afropessimismus herum zu organisieren. Die Schwarzen, die sich dem Afropessimismus zugehörig fühlen, sind entweder unter 25 oder über 65. (Lacht) Alle anderen dazwischen versuchen nur, ihr Leben zu leben. Sie sind nicht bereit, alles in die Luft zu jagen. Wenn du aber die 65 hinter dir hast, siehst du, was für ein Desaster dein Leben gewesen ist und wie all deine Träume mit Füßen getreten worden sind. Und wenn du die 25 noch vor dir hast, bist du noch nicht auf dem College, oder du lebst im Ghetto, und dir ist eigentlich alles egal. Die Ohnmacht ist eine Sache der mittleren Jahre.
Ich muss an meinen Vater denken, der als Vizepräsident für die Universität von Minnesota sehr viel getan hat. Als er pensioniert wurde, fragte ich ihn einmal: »Welches Gebäude werden sie nach dir benennen?« Während es überall Denkmäler und Gebäude zu Ehren der weißen Vizepräsidenten gibt, ist nicht einmal eine Parkbank nach meinem Vater benannt. Mein Vater musste lernen, dass Anerkennung und Eingliederung Homologien – oder vielleicht Ausdrücke – dessen sind, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und als solche konnten sie nicht auf ihn als Schwarzen ausgedehnt werden.
MSB: Sie zeigen, wie die Schwarze Existenz auf dem strukturellen Ausschluss auch aus der Welt menschlicher Kategorien basiert, während diese umgekehrt ihre Kohärenz aus diesem Ausschluss ziehen. Ich will versuchen, dies mit etwas zu verbinden, was ich für einen der faszinierendsten Aspekte Ihres Schreibens halte und was Sie einmal mit dem Wort »aleatorisch« beschrieben haben: Für mich durchbricht Ihr Schreiben Strukturen konventionellen Erzählens. So ist Ihre Ästhetik direkt verbunden mit Ihren Theorien: Immer- hin beginnt Ihr Buch mit dem schon erwähnten Zusammenbruch, der selbst eine Folge der Einsicht in den afropessimistischen Zusammenhang ist, wenn man das so sagen kann.
Wilderson: Ja, das hoffe ich. Mein zentraler Punkt war, dass sich die Schwarze Psyche immer in einem Zustand des Wahnsinns befindet. Der Schwarze betritt den Raum, und die Phobie ist körperlich. Sie steckt in der Haut. Und wenn man so ein Leben lebt, dann fühlt man das unmittelbar: Man kann den Raum, niemals als jemand betreten, der transformative Fähigkeiten besitzt. Man ist immer fixiert wie das Foto im Entwicklungsbad. Das bedeutet, dass man eigentlich keinen Bogen vom Wahnsinn zur Vernunft schlagen kann. Man steckt fest. Das wollte ich in meinem Buch Afropessimismus zeigen.
Foto: (c) John Blom