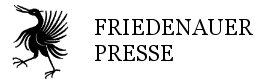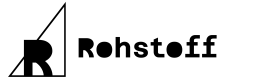Film
Lushin war kein »Kinogeher«. Ein Kino besuchte er nur einmal – nach dem Ende seiner Schachkarriere. Die in den Räumen des Filmkonzerns »Veritas« hängenden Fotos, auf denen ein blasser Mann mit starrem Gesicht und großer amerikanischer Brille zu sehen war, der mit den Händen am Gesims eines Wolkenkratzers hing – drauf und dran, in die Tiefe zu stürzen, sagten ihm nichts. Für Nabokov die Andeutung von Lushins Ende – Fenstersturz.
Bei Goldstein heißt der »Kinogeher« Djalil. Djalil, Gründer und Herausgeber eines satirischen Wochenblatts, des »Molla Nasreddin«, entdeckt, nach dessen Verbot, für sich das Kino. Die aserbaidschanische Zeitschrift war 1906 in Tbilisi gegründet worden, erschien dort bis 1914, wenige Ausgaben wieder 1917, 1921 kam sie einige Zeit in Täbriz (Iran) heraus und ab 1922 in Baku, wo sie ihr Erscheinen, nachdem der »Befreier die Depesche erhalten hatte«, einstellen musste. »Auf dem Titelblatt des letzten Nasreddin melkte die Kreml-Meute die Erdöl-Förder-Kuh des Apscheron«.
Das Satire-Journal, den Ideen der Revolution von 1905 verpflichtet, vor allem Ideen der Arbeiterbewegung Transkaukasiens, attackierte die patriarchalischen Gewohnheiten im Alltag und fand im gesamten Nahen und Mittleren osten verbreitung. Als die Macht in die Hände der Sowjets übergegangen war, unterstützte es in einem volksnahen Stil den Aufbau des Sozialismus, ohne die Vorgänge zu kommentieren, in Grammatik und Wortwahl einem Subtext vertrauend, der Raum zwischen den Zeilen ließ.
Hinter Djalil, zu diesem Zeitpunkt führend bei der Latinisierung des aserbaidschanischen Alphabets, »ein Karl Kraus aller Türken der türkischen Oikumene«, verbirgt sich Djalil Mamedkulisadé (1866–1932), Journalist und satirischer Autor, geboren in Nachitschewan, einer aserbaidschanischen Exklave, umschlossen von Armenien und Iran, unterrichtet von den Mullas der Stadt und später Zögling am Lehrerseminar in Gori, Stalins Geburtsort. Seine Bildung beruhte auf arabischen und persischen Büchern, vor allem der Poesie Saadis aus Schiras, des bedeutendsten klassischen Dichters Persiens.
»Dem Befreier gefiel der alte Djalil. Solide und glatzköpfig…, er war elegant in seinen übertrieben höflichen, ironischen Bewegungen, achtungsvoll gegenüber der Unterklasse der Waschfrauen, Putzfrauen, Dachdecker, Wächter, freundschaftlich gegenüber dem unterstellten Starkasten des Molla Nasreddin, der gegen die Obrigkeit stichelte. Leuchtturm für Verirrte, Stechfliege der Juvenalien, respektable Figur der von ihm über sich selbst in Umlauf gebrachten Witze. Drei Narrengesichter an einem Kopf, einschließlich des eigenen, todernsten.«
Am »Molla Nasreddin« arbeiteten hauptsächlich drei Karikaturisten, die das gesicht dieser Zeitschrift, in mancher Hinsicht einem Comic ähnlich, Teile der Leser waren des Lesens unkundig, prägten: Oskar Schmerling, ein in Tbilisi lebender deutscher Zeichner, Joseph Rotter, Absolvent der Münchner Akademie der Bildenden Künste, und Asim Asimsadé, in der Bakuer Zeit Chefkarikaturist.
Bei einem meiner Aufenthalte in Tbilisi war ich jenseits des Mtkwari den steilen Hang zum Haus Iosebs Grischaschwilis hinaufgestiegen, eines georgischen Satirikers und Feuilletonisten, zu dessen Texten Schmerling zahllose Zeichnungen beigesteuert hatte, um sie hier in Mappen und an den Wänden zu betrachten. Die Farbigkeit der Originale und die feste Umrißlinie ließen an Arbeiten aus dem »Simplizissimus« denken, ein Stil, der die Zeichnungen im »Molla« stark prägte.
Ismail-Effendi, der Asim Asimsadé (1880–1943), Karikaturist bei »Molla« zum Vorbild hat, sitzt in seinem »zweiten Leben« in Tel Aviv und versorgt, aus welchen Quellen auch immer, die großmutter des Erzählers mit Zigaretten der Marke »Belomorkanal«, eine für die russen ebenso legendäre Marke wie für die Franzosen »Gitanes« oder die Kubaner »Ligeros«.
»Ismail-Efendi, glatzköpfig, ein empfänglicher Mensch mit kompliziertenBedürfnissen, nach dem Scheitern seines misanthropischen Chefs überall verjagt, schnüffelte Äther, rauchte doppelt starkes Oguz-Haschisch, zeichnete heimlich für private Auftraggeber aufreizende Bildchen für den Sieg über die Schwanzschwäche, als Satiriker und Pornograf malte er die Gesäßbacken der NKWD-Büffet-Mädchen, die hängenden Schwengel der Parteikommissare, für besondere Bezahlung bediente er, bleich vor Angst… die Homosexuellen mit seinen Bildern im Stil der Schule von Herat.«
Was mag dieser phantasievolle Zeichner sich beim Anblick der schäbigen Zigarettenschachteln gedacht haben? Auf den schlüpfrigen Stufen eines Ladens in der Bogojawlensker Straße, wo man sich gerade um Fisch stritt, verhaftet, wird er die auf den Zigarettenpackungen aufgedruckten Weißmeer-Kanal-Wellen aus bald nächster Nähe erleiden. Darüber schweigt er sich aus: »Ich habe das Böse der Erde gesehen und es im Innern verziehen«.
Nach dem Verbot des »Molla« taucht Ismail in einem Zigarettenkiosk unter und versucht, »obszöne Schmierereien«, wie der erste Kunde sagt, an den Mann zu bringen. Der Kiosk liegt günstig. Gegenüber ein »riesiges mauretanisches building«, das Saadi-Haus (der persische Dichter!!), ein protziger Bau mit viel Marmor, Büros, Verwaltungen, Finanzinspektoren, auf dem Dach ein Sommerkino, in der obersten Etage das Restaurant »Gjulistan« (eines der Hauptwerke des persischen Dichters ist »Rosengarten«, persisch »Golestān«, in Europa und Amerika schon seit dem 18. Jahrhudert als Mode des Orientalismus bekannt).
Im »Gjulistan« trifft sich ein besonderes Publikum, Halbwelt und große Welt, die künstlerische Bohème mit den entsprechenden Damen, heimlichem Rauschgifthandel, ausgesuchten, Fremdsprachen beherrschenden Kellnern, um die »Organe« entsprechend informieren zu können. Die »Organe« betreten einmal pro Woche weit nach Mitternacht das Etablissement zum »kaukasischen Roulett«, 39 Gäste, Männer wie Frauen, vom Hauptmann mit dem Ruf »Du!« aufgefordert, gehen widerstandslos, für die Zurückgebliebenen das Zeichen zum Beginn einer ungezügelten Orgie.
In diesem Milieu verkehrt Dojwber Galperin (ein geheimnisvoller Abenteurer zwischen Deutschland, Russland und Israel), ein deutscher Tigerbändiger. Als er eines Tages mit Zeichnungen Ismail-Efendis dort auftaucht, wird das »Gjulistan« kurz darauf verwüstet. Alle Gäste, die Kellner, der Hauptmann, kommen um, von Typen in Zivil, die hinter den Säulen hervorspringen, erdrosselt, erschossen, ein Massaker, das bis ins Erdgeschoß zu hören ist. Nur einer – Galperin – verlässt wie ein amerikanischer Gangster in Hut und Garbadine-Trenchcoat (natürlich als eine Replik auf die entsprechenden Filme) das Gebäude und verschwindet in der kaspischen Feuchtigkeit, hört auf einem Basar vom Militärphonographen die Rede Enver Paschas an aufständische Soldaten, in dessen Gesicht er Züge Lenins wie auch Atatürks erkennt, letzterer aber eher dem Gesicht des scheinbaren Tiermenschen Aljechins, des Schachweltmeisters, ähnelt mit seiner Nazikollaboration und dem merkwürdigen Tod im portugiesischen Estoril. Das ist ein großartig erzähltes Kapitel.
Im Restaurantnamen »Gjulistan« scheint noch eine weitere Ebene auf, als nur die Erinnerung an Saadi und den »Rosengarten«. Gjulistan war ein von Armeniern bewohntes aserbaidschanisches Dorf an der Grenze zu Berg-Karabach, aus dem nach dem Krieg um dieses Gebiet 1991 alle Armenier vertrieben worden waren. Das Dorf liegt heute entvölkert in einer Sperrzone. Nach dem russisch-persischen Krieg (1804–1813) wurde in diesem Dorf der Frieden von Gjulistan geschlossen, in dem sich Persien mit dem Verlust seiner Gebiete (ganz Georgien, große Teile Aserbaidschans) abfinden musste, ein vertrag, der noch heute im Iran als Schandvertrag angesehen wird. Geschichte holt die Gegenwart wieder ein.
***
Die vielen intertextuellen literarischen Bezüge, sowohl die offenkundigen als auch die versteckten, weitet Goldstein mit dem »Kinogeher« Djalil auf den Film aus. Das darf bei Goldstein nicht mit filmischer Schreibweise verwechselt werden, die seit fast hundert Jahren schon die moderne Literatur bestimmt, bei ihm ist das fundiertes Interesse am anderen Medium, das seinem Prinzip, durch Beobachten zu erzählen und das Gesehene nicht zu kommentieren, entgegenkommt. Sein Protagonist kommt vom Schreiben zum Sehen, Kino wird für ihn zur Nahrung, das Essen in der Literatenkantine ist ohnehin schlecht. Aus der Ruhelosigkeit und Leere, die Djalil am Tag nach der Schließung seiner Zeitschrift »Molla« überfällt und aus der schrecklichen Einsamkeit des zweiten Tages, flieht er, erst auf den Boulevard, dann ins Kino. es sind Stummfilme, die er, manche sogar mehrmals, sieht, deren Inhalt der Erzähler, auch teilweise referierend, wiedergibt, die Filme collagiert, auch fiktionalisiert. Hier braucht es keinen Dialog, diese Materie ist sprachlos.
Diese Filme machen aber auch Djalil stumm, wochenlang spricht er nicht, verständigt sich durch Zeigen, durch Gesten. Sein Favorit wird Harold Lloyd, der Mann mit der Hornbrille, der nie lächelt. Den anderen Komiker, den mit der Melone, liebt Djalil nicht, er ist ein »Pazifist der Zweibeiner«, also für die Mentalität jenes Raumes zu nobel, zu distanziert.
Djalil sieht Safety Last (dort rettet sich Lloyd in letzter Minute am Zeiger einer Wolkenkratzeruhr) oder Girl Shy (wo er seiner Angebeteten nachjagt), Rettung stets als Resultat des Zufalls, nicht des Schicksals. Dies mag dem Lebensgefühl vieler Sowjetmenschen entsprochen haben, nur das Happy End, das der Filmkomödie eingeschrieben ist, fehlte immer.
Der Zufall als Verbindung unzusammenhängender Ereignisse zeichnet Goldsteins Poetik aus, ist dem Chaos eines Zusammenbruchs (des Zusammenbruchs eines Imperiums) immanent, bei dem nichts vorhersehbar ist, vom Autor auch nicht in eine Kausalität gepresst wird, der Ursache-Wirkungs-Reflex ist neutralisiert.
Nach dem amerikanischen wendet sich Djalil dem deutschen Kinematographen zu: dem Verbrechen in der düsteren Stadt. All das bisher Gesehene fasst der deutsche Film zusammen, bündelt es in einem Sujet, das in der sowjetischen Kinematographie mit solcher Konsequenz und Stilsicherheit nicht zu entdecken war.
Er sieht M, erkennt im Messer, mit dem die Kehlen der Opfer durchtrennt werden, die Klinge, mit der man auf dem Markt am Bahnhof den Schafskäse in Scheiben schneidet, in den unbedeckten Gesichtern der im Laub versteckten Opfer ägyptische Totenporträts, auch die Porträts Verstorbener, die sich die Daglinen auf dem Parapet an das Revers heften, rückt also die Filmgeschichten direkt an die unmittelbare, von ihm erlebte Realität heran.
Das Cabinet des Dr. Caligari, das Irrenhaus als Zentrum der Ereignisse und die Schlafwandler in den Gassen, hinterläßt bei Djalil einen ambivalenten Eindruck, das ist unbegreifliche Realität, eine die erst noch kommen wird, eine Nase auf dem Newski-Prospekt, das ist noch vorstellbar, diese aber nicht.
Metropolis überrascht Djalil, verwirrt ihn durch seine Struktur, ruft ein Schimmern und Pulsieren hervor, das bald in einen Fiebertraum der Kindheit übergeht.
Daß Kinematographie nicht mit dem rein physischen Sehvermögen gleichzusetzen ist, den Augen jenseits des Sichtbaren nichts überlässt, ist ein Trugschluß, der »Kinogeher« erlebt es in diesem Film. Ich lese es als Hinweis Goldsteins auf sein eigenes Schreiben, das oftmals an Fieberträume erinnert, an einen Wortrausch, einen sound, an »Blindfelder«, die assoziationen jenseits der Worte schaffen.
Die weiblichen Kinogänger, so der Erzähler, bevorzugen mehr Sinnliches, schöne Männer und Liebe, ihr Held ist Rudolf Valentino, ein frühes männliches Sexsymbol des Stummfilms. Die Augen der Damen hängen an dem schönen Italiener als Scheich Ali ben Hassan in Der Scheich oder als tangotanzender Gaucho in Die vier Reiter der Apokalypse. Bei Valentinos Begräbnis 1926 in New York sollen hunderttausend Menschen seinem Sarg gefolgt sein, in dem seine Wachspuppe lag, man fühlt sich an sowjetische Begräbnisrituale erinnert. Auch in den städtischen Kinos am Kaspischen Meer vergossen die Damen Tränen darüber. Ein Großereignis allerdings lockte die Frauen heraus: die Gladiatorenkämpfe im Colosseum, eine der drei Großtaten des Befreiers – Spiele. Die unmittelbare Realität der Spiele siegt über eine künstlich vermittelte auf der Kinoleinwand. Die Nonne Walentina, aus einem nördlichen Kloster zu den Duchoborzen gekommen, wohnt zwar den Spielen bei, stumm und schwarz gekleidet, bleibt aber der Totenmesse für Valentino in verlassenen Kinosälen treu, Sessel zwölf, Reihe drei.
Djalil stellt ein Manko fest: er stößt auf düstere Leerstellen, auf blinde cadres. Sollten die von den Grenzen des Stummfilms bedingt sein? Könnte der Tonfilm jene blinden cadres nicht ausfüllen? Doch der Tonfilm versagt. Die Bilder von der großen Hungersnot, der Welle des Hungersterbens in der Ukraine 1930/32 findet Djalil nicht im Kino. Die Kinochronik hält sie nicht fest. So macht er sich selbst auf die Reise und phantasiert sich das Gesehene ins »eigene« Kino, sieht seine »Kopfbilder« auf der Leinwand, die aufgerissenen Münder, die zusammenbrechenden Alten, die hundertdreiundzwanzig blinden Banduraspieler auf einem Lastkahn, mit einem Kanonenschuß vom Ufer aus versenkt, den Kannibalismus. Der Hunger war unhörbar, unsichtbar, zu sehen war er nur in diesem Kino. Goldstein führt Djalil vom Beobachten zum Sehen, wie er zuvor ihn vom Schreiben zum Sehen gebracht hatte.
Das war nicht die erste Hungersnot nach der Revolution. An der Wolga hatte Eduard Tissé, langjähriger Kameramann Sergej Eisensteins, Bilder von der Hungersnot 1921/22 gefilmt, die Regisseure Wladimir Gardin und Wsewolod Pudowkin hatten aus dem Material den Dokumentarfilm Hunger…Hunger…Hunger montiert, der im Ausland gezeigt wurde, um Hilfe, vor allem aus den USA zu organisieren, aber auch in Deutschland bildeten sich damals Hilfskomitees. Der Film ist nicht erhalten. Beim Hunger in der Ukraine war Hilfe verboten, die Katastrophe sollte unentdeckt bleiben.
Einer der Regisseure jenes Hungerfilms, Wladimir Gardin, tauchte später als »Bürger mit der Chrysantheme« in einem weiteren spektakulären Stummfilm, den Djalil gesehen haben dürfte, auf. 1932 drehte Nikolai Schengelaja, gemeinsam mit Stepan Keworkow 26 Kommissare für Azerfilm Baku, der die Geschichte der Bakuer Sowjetrepublik erzählt. Der Film trägt deutlich die Stilistik Nikolai Schengelajas, die er in Elisso (1928) herausgebildet hatte. Gesichter in Großaufnahmen, lange Einstellungen, äußerste Stilisierung und Kargheit. In 26 Kommissare heißt das:
Linien und Horizonte der Dünen bei der Erschießung der Kommissare in der turkmenischen Wüste, Typisierung der Klassenzugehörigkeit durch Maske und Kostüm, der Bolschewik als Heldentypus, immer bereit zu stürmen oder eine Granate zu werfen, die Bürgerlichen, die Ausländer eher Karikaturen, die Seite des Gegners bleibt fast anonym, von den Türken kaum die rede. Das Remake des Films von 1965 ist nur noch ein einziges propagandistisches Heldenlied – auch das die Funktion von Kino.
Der Autor bietet zwei Versionen vom Ende Djalils: Zum herumziehenden Nomaden geworden, unbehaust, das Kino als Zufluchtsstätte geschlossen, Leiter und Vorführer entlassen, verkommt er zusehend (das erinnert an das Paar aus Krasnodar, das neben einem Bankautomaten auf der King-George-Street in Tel Aviv um Almosen bettelt), erfriert auf einer Bank im Freien.
Nach einer anderen Version wird der Maître Djalil zweieinhalb Tage nach seinem Tod in der Wohnung aufgefunden, der Geruch war nach draußen gedrungen.
Copyright: Radonitzer 2016