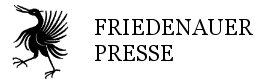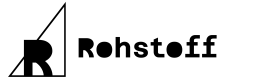Zur Präsentation des August Verlags Berlin in der Buchhandlung Walther König, Berlin, 4. Dezember 2009.
Warum brauchen wir? und lieben wir? kleine Verlage, und erst recht diesen? Das ist eine einfache Frage, die jeder an meiner Stelle hier beantworten könnte. Ich zähle nur auf:
Warum brauchen wir kleine Verlage im Angesicht der großen Namen, die zwischen den tieferen Bedeutungen ihrer Namengeber schwanken und dem Ambiente, das sie den Signifikanten abgewonnen haben: die ihre Netze auswerfen wie Fischer, kaufmännische Seriosität suggerieren wie Hanser, einen Aufbau zitieren oder die Faßsäure, die bei Suhrkamp einen guten Jahrgang nach dem anderen verspricht. Vom Fink-Gezwitscher noch zu schweigen, das dem Nachwuchs gehört und gern eine University Press wäre. Wozu also die kleinen, wenn nicht darum, den großen Namenspolitiken, ihren Ansinnen von Etabliertheit und Gesten der geliehenen Bedeutsamkeit zu entkommen? Wer wollte sich nicht – und will dann von Fall zu Fall doch lieber nicht – als ein wohlanständiges Stück Suhrkamp-Kultur in akademisch reussierten, politisch korrekten oder historisch flächendeckenden Reihen von Regalen beigesetzt sehen? Kurz und gut, wir brauchen sie, die kleinen Verlage an den ungesicherten – akademisch, politisch, moralisch ungesicherten – Rändern der öffentlichen Diskurse, am Rande der Prätentionen von „Öffentlichkeit“, im Zersplittern wie dann in den Splittern der aktuellen „normative orders“. Erstens.
Sodann, da kommen wir in unserem Brauchen dem Lieben noch näher, schätzen wir die kleinen Verlage in ihrer Vielzahl, und sei dies um den Preis ihrer Kurzlebigkeit, welche bekanntlich schon den Journalen der Romantik nicht abträglich war. Die unsystematische „Varietät“ der Randzonen – ein Titel von Paul Valéry, der Avantgarde machte – erfordert eine immer neue Ernsthaftigkeit im Einzelnen, ohne Rücksicht auf die klassischen Linien der Großen, und ohne Rücksicht auf die drohende Vergänglichkeit der Probleme, die doch weitgehend eine der begrenzten Ausdauer des Problembewußtseins ist. Zweitens.
Und, das ist nicht alles, in der Kürze der kurzfristigen Konstellationen liegt die Würze der gekonnten Pointen. Viele akademische, forschungspolitische und auch öffentliche Felder brauchen gezielte, ja leidenschaftlich impertinente, auch obsessive Interventionen, die nur untergehen können in den gewichtigen, übergeordneten Hinsichten der großen verlagspolitischen Profile. Nicht nur brauchen wir den kleinen Platz zur gezielten Pointe, wir lieben das Spiel auf engem Raum, das ohne Rücksicht auf die Resonanz der Zahnärzte an der Ecke heraus gespielte Tor (und ginge der Ball auch daneben). Drittens.
Nun sind wir schon – und Sie sehen förmlich wie wir sie brauchen – beim vorliegenden Fall einer solchen Initiative und ihrem exemplarisch abgesteckten Terrain. Auch dieser kleine Verlag tut etwas, was andere kleine nicht tun und große nicht unbedingt kümmert. Die Verlegenheit ist aber keine ausnahmsweise, sie hängt daran, dass man hier von etwas weiß, was andernorts nicht nur als weniger oder un-interessant gilt, sondern längst nicht – vielleicht auch längst nicht mehr – in den Blick gekommen ist. Viertens.
Denn, das ist der Punkt: Die Avantgarde, die es in der Kunst längst nicht mehr gibt oder nur noch unter äußerster Quälerei gibt, hier gibt es sie noch. Ihr neuerer Name war einmal „Theorie“ und es gab und gibt sie – das ist weniger bekannt als ihr Name – nur unter bestimmten öffentlichen Bedingungen. Wäre ich Rancière (was ich ja bestimmt nicht bin, mit dem ich mich in dem Punkt aber anfreunden könnte), dann würde ich von „Politiken“ sprechen, denn was gemeint ist, ist eine theoretische Praxis eher denn eine dogmatische Idee, und diese Praxis liegt just an dem vom Verlagsprojekt genannten Schnittpunkt von Philosophie und Kunst. Fünftens.
Der Schnittpunkt von Philosophie und Kunst ist proto-politisch, eine Praxis, die Raum braucht und hier findet. Fünftens, aber nicht letztens, denn noch ist der Gründungssage nicht gedacht, die diese wie jede Avantgarde mehr denn die Arrièregarden auszeichnet, die mit der kargen Kost der bewährten Geschäftstraditionen auskommen müssen.
Die unter dem hochsommerlichen Mond des August stehende und wohl tatsächlich unter ihm beschlossene kleine Verlagsinitiative, die unter den Fittichen eines großen Walthers und Königs zustande kam, und mit dessen Jupiter-artiger Position in der Kalenderfolge vom großen Julius zum hehren Augustus ein alt-römisches Moment hervorgekehrt wird, folgt einer insgeheimen List der Vernunft. Das wird deutlich, wenn wir uns vor Augen halten, daß die Maria, der sie zu danken ist, eine Dissertation zur Geschichte des Gründungs-Heiligen aller gegenwärtigen Diskurse verfaßt hat, zu Michel Foucaults Genealogie der Biopolitik im Werk von dessen Lehrer Georges Canguilhem. Dies Unternehmen einer Genealogie, so lautet die auf den Gründer Foucault selbst zurück gehende Legende, ist gegen den Strich aller Jupiterischen Souveränitätsgeschichten zu lesen, welche im weltgeschichtlichen Übergang vom Juli zum August – in der Zeitenwende von Julius Caesar zu Caesar Augustus – ihre verhängnisvolle Prägung erfuhr (und heute übrigens fälschlich unter dem Namen der „Politischen Theologie“ verhandelt wird).
Dieser Zeitenwende eingedenk (ich suche mich kurz zu fassen), datierte der Dichter Vergil seine ominöse Prophezeihung von einem rettenden himmlischen Kind (in dem man prompt den in den Tagen des Augustus geborenen Jesus von Nazareth erkennen wollte) auf den Monat August: auf das Fest der Astraea am 15. Nun ist im August der 15. nicht der Jupiter-Tag der Iden wie er es im März und im Oktober ist, denen beiden auch Verlage gewidmet sind, und die als die Eckdaten des von Julius Caesar reformierten Julischen Kalenders gelten können. Sie kennen die Bedeutung der Iden des März als des nachgerade sakralen Datums des Königsmords an Caesar. Im Fall der jungfräulichen Astraea handelt es sich um das Gegenprogramm: Denn diese Tochter des Zeus und der Themis ist die vertriebene Göttin von Recht und Gerechtigkeit; sie soll vom himmlischen Knaben, den Vergil in Augustus sah, zurückgeholt werden auf die Erde – was in feiner, hier das Maß des vernünftigerweise Referierbaren weit übersteigender Bezüglichkeit von der römischen Kirche zum Fest Mariae Himmelfahrt erkoren wurde. Und was dann, in probater Renaissance-Verschmelzung der Motive Shakespeares Virgin Queen Elizabeth zum Muster diente. In den romanischen Ländern hat es dies Datum bis auf den heutigen Tag als Hochfest erhalten, wo es von der kleinen Maria in Spanien (ich habe sie gefragt) „Jahr-aus Jahr-ein als Wendepunkt des Kinderjahres“ erlebt wurde.
Zurecht erweist sich mithin der August als eine Art figura cryptica, wenn nicht stracks der Biopolitik, so doch als Schattenriß eines neuen Politikbegriffs: als Figur einer List der Vernunft, Antidote eines neuen, der theologisch-politischen Souveränitätskonstellationen sich entschlagenden Machtverwaltungsdispositivs. Noch der Machiavell der neuen Prinzen hat sich wohlweislich der Schutzmantelmadonna zu versichern gewußt, die im Sternenkreis der EU-Fahne unsichtbar auf blauem Grund und wenig erfolgreich waltet, was die homines sacres an den Grenzen Europas angeht. Letztens.
Anders also als die revolutionäre Attitüde von März- und Oktober-Unternehmen in ihrer unverbesserlichen alt-jupiterischen Fixierung zeigt sich der August Verlag an neuen Politikbegriffen interessiert, deren Genealogie er nachgeht. Die Achse Canguilhem-Foucault ist dabei Programm, zentraler Punkt eines Programms, das genealogisch und nicht geistesgeschichtlich, nicht schuldgeschichtlich, nicht leitkulturell operiert und darin gut ist für Überraschungen. Auch Südafrika ist kein Zufall, sondern exemplarisch für den von Jacques Derrida entwickelten „new sense of the political“.
Dem neuen Sinn des Politischen ist im Kleinen eines kleinen Verlags sehr unterschiedlich gedient. Im individuellen Fall dieses Verlags hängt viel an der französischen Schiene, für die Maria Muhle spätestens seit La Fabrique die nötige Expertise mitbringt. So hat La Fabrique ein französisches Format des intellektuellen Austauschs und Öffentlichmachens im emphatisch kleinen Verstande verfeinert, das unabhängig von Verkaufserwartungen die Kunst des Lesens auf kleine nach-akademische, post-graduiertenkollegsartige Kreise hin öffnet und anstelle der dogmatisch vertretenen, marktförmigen Konsenssynthesen – der traurigen „Konsenssepps“ wie Goetz sie mit bewährtem Elan nannte – das Buch zur Gelegenheit kleiner Lektüren, etwa und vorzüglich in den Transits der entfremdeten Berufswelt werden läßt und der mitlaufenden alltäglichen Reflexion den Rücken stärkt.
Das fördert an der Stelle öder Begründungsverpflichtetheit offiziöser Verlautbarungen, worin die wissenschaftliche Sphäre sich ohne Not MBA-artigen Diskursen unterworfen hat, den professionellen Eigensinn fachspezifischer Un-Ordnungen. Wohl haben sie die ungeordnete Form der Seminarpapiere hinter sich gelassen, verlangen nun aber nicht – das wäre das letzte – die konsensuelle Approbation durch erklärtermaßen kenntnisfreie Medien. Auch an den Alibis und Plattitüden vorgeschützter Anerkennung kann nicht viel liegen in diesem Raum der sachbezogenen Arbeit, die in der Eröffnung dieser Art der öffentlich-professionellen Darlegung ihre Sachbezogenheit immer neu zu artikulieren, und die ihr eigene Normativität immer neu zu entdecken habt. Das ist das Feld der Kleinen Reihen wie La Fabrique oder Merve und nun besonders dieser hier, die den philosophischen Ort des Lesens vom gesprengten kleinen Sozialsystem des Seminars in die Manteltasche des Reisenden in den non lieux vom rechten Wege abweichender Politiken verlegt.
Die Kleine Reihe kommt im marianischen Blau zur Welt und setzt sich fort mit Flauberts Papagei Loulou, der wie von Sinnen „Je vous salue Marie“ plappert. Sie dient der aufs Äußerste geschärften Pointe des akademisch Vertretbaren. Es sind auf diese Weise fast artistische Ornamente im Kleinen, die der französischen Essaistik nahe stehen ohne deren Künste nachmachen zu können – die, mit anderen Worten nicht nur den Mut zur Kürze, sondern auch zum Unfertigen, womöglich Halbgeglückten, aber deshalb umso Diskussionsdienlicheren haben sollen (also dessen, was ein gewisser Sloterdijk, die Form der gänzlich Satire verfehlend, ins anmaßende Genre der CEO-freundlichen Welterklärung bringt). Eine neue Exemplarik, eine neue Praxis der Theoriebildung ist Sache dieser Reihe, und das ist keine Frage der Postulate, sondern allein schon des bedachten Versuchs, so ungelenkt eine solche Praxis beginnen muß.
In den wissenschaftshistorischen Ernst im Großen versetzend, liefert das Große Format in seinem ersten Projekt, der Übersetzung eines der zentralen Werke von Canguilhem ein massives Exemplar solcher Exemplarik – nichts könnte programmatischer sein als dieses Desiderat. Als Pendant aus derselben Foucault-Formation fällt mir ein komplementärer, trotz aller Foucault-Infatuation unübersetzt gebliebener Text ein, auf den bei Foucault das Projekt einer anderen Geschichte und einer anderen Politik so unmittelbar zurückgeht wie auf Canguilhem, das Werk des anderen Foucault-Lehrers Georges Dumézil, wo Sie den Kontext meiner August-Geschichte nachlesen können, exemplarisch in der Geschichte des Oktober-Pferds oder in Dumézils Meisterstück „Jupiter-Mars-Quirinus“. Kurz, es gibt die Konturen eines Programms. Es ist also nicht einfach nur abzuwarten (das immer auch), es liegt erkennbar vor, und das läßt sich dankbar feiern.