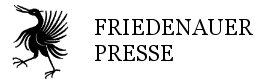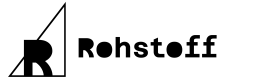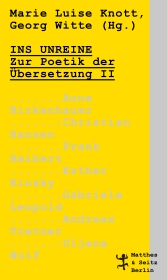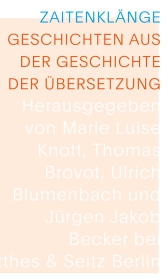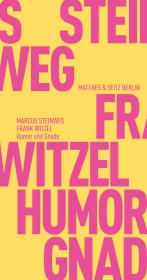Sicherheitshinweise entsprechend Art. 9 Abs. 7 Satz 2 GPSR entbehrlich.
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich gerne an uns über das Kontaktformular oder die u.g. Adresse.
»Marie Luise Knotts Kunst liegt im Subtilen: in der Ausstellung von Ambivalenzen, in den Wiedererkennungsmomenten über die politischen und ästhetischen Lagergrenzen hinweg. Lässt das Szenario schicksalhaftes Raunen, apokalyptische Floskeln befürchten, so nähert sich Knott den Momenten des Jahres 1930 behutsam und leise. Es gelingt ihr, den Dampf und Qualm der ausgehenden ›Roaring Twenties‹ in kühlen Beobachtungen kondensieren zu lassen. An die Stelle methodologischer Vorreden tritt die Reflexion über Fenster und Blick, Bühne und Zuschauerraum.«
– Marcel Lepper, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Gerade die Versuche, Abgründe zu überwinden, .... offenbarte den Verlust von Verbindendem. Theater und Salons waren nicht mehr Räume der Gemeinsamkeiten. die Sprache zersplitterte. Der Schluss auf die Gegenwart ist nicht zwingend, aber aufschlussreich.«
– Nicolas Freund, Süddeutsche Zeitung
»In Knotts inspirierenden Essays drängen sich automatisch Vergleiche mit der Gegenwart auf. So denkt man bei Piscator an Frank Castorfs ›Volksbühne‹ oder bei Karl Wolfskehl an den ähnlich fulminanten Vortragskünstler Thomas Kling. [...] Man fragt sich unwillkürlich, ob es heute ein Werk gibt, das die Gegenwart genauso durchdringt wie Paul Klee 1930 mit seinem fasziniert-drohenden Bild ›Neues Spiel beginnt‹. ...
– Helmut Böttiger, Deutschlandfunk
»In vier nicht nur stilistisch glänzenden Essays betrachtet die Kritikerin und Übersetzerin Marie Luise Knott […] Momente des Jahres 1930.[…] Sie stellt schmerzliche Fragen an die künstlerische Moderne. Doch verabschiedet sie die Kunst nicht in eigene Sphären, sondern fordert sie auf, das Konstrukt des autonomen Individuums zu verteidigen.«
– Moritz Reininghaus,Tagesspiegel
»›Dazwischenzeiten‹ ist ein ebenso eigensinniges wie aufschlussreiches Buch zur Weimarer Republik, das nah an seinen Autoren bleibt, indem es sie ausgiebig zitiert. Sogar Brechts oft geschmähtes kommunistisches Lehrstück ›Die Maßnahme‹ – auch von 1930 – erscheint in neuem Licht, nämlich als mögliche Totalitarismuskritik.«
– Hans-Peter Kunisch, philosophie magazin