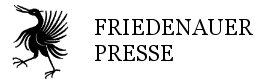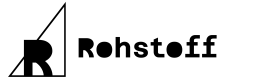Der folgende Text wurde während eines Gesprächs mit Kathrin Busch und Morten Paul, das diffrakt und der August Verlag am 28. Oktober 2021 anlässlich der Veröffentlichung von Unworking und Die Hoffnungslosen in Berlin veranstaltet haben, vorgetragen und im Anschluss geringfügig bearbeitet.
Zum Beitrag »Radikalisierte Passivität« von Kathrin Busch
In dem Buch Die Hoffnungslosen wird einerseits der Begriff der Hoffnung entwickelt, im Ausgang von Benjamins Satz, Hoffnung sei uns nur um der Hoffnungslosen willen gegeben. Andererseits wird der Begriff aber in dem Buch in eine Konstellation gerückt, das heißt: er wird nicht so sehr entwickelt als dass verschiedene und auch miteinander unvereinbare Aspekte nebeneinandergestellt werden, um ein Spannungsfeld zu erzeugen. Das ist die Aufgabe der Zitate von Robert Walser und Georges Bernanos. Das eine steht dem Buch voran, das andere ist auf dem Buchrücken abgedruckt. Das Zitat von Bernanos lautet: »Die Hoffnung ist eine Bestie, sage ich Ihnen, eine Bestie im Menschen, eine mächtige, wilde Bestie. Am besten lässt man sie ganz sanft dahinscheiden. Wenn nicht, darf man sie keinesfalls freilassen. Lässt man sie frei, dann kratzt und beißt sie.« Das Zitat von Walser lautet: »Wir Zöglinge hoffen nichts, ja es ist uns streng untersagt, Lebenshoffnungen in der Brust zu hegen, und doch sind wir vollkommen ruhig und heiter. Wie mag das kommen?«
Das Buch schafft also ein Spannungsfeld mit mindestens drei Bestimmungen der Hoffnung. A) Die Hoffnung ist das, was uns gegeben ist, aber nicht für uns, sondern für den anderen, den Hoffnungslosen, dem die Hoffnung nicht gegeben ist, als wäre die Hoffnung nie die Hoffnung des einen oder des anderen, sondern immer eine Hoffnung, die sich niemandem zuschreiben lässt. Niemand darf sich auf die Hoffnung berufen und sagen, er sei hoffnungsvoll, habe eine Hoffnung, nicht einmal der Hoffnungslose, für den sie uns gegeben oder anvertraut wurde. Das einzig mögliche Verhältnis zur Hoffnung, das einzig mögliche Verhältnis, das die Hoffnung erlaubt, ist ein Nicht-Verhältnis, eine Hoffnungslosigkeit. B) Die Hoffnung ist das, was wir im Zaum halten müssen, weil sie uns sonst überfällt und zerreißt: sie hat etwas Übermäßiges, eine Selbständigkeit, die wir nicht in den Griff bekommen, die uns mitreißt, uns nicht mehr loslässt, uns unserer selbst entfremdet, uns abhängig macht, uns verschlingt, uns unsere Selbständigkeit raubt. Die Hoffnung ist eine verhängnisvolle, hoffnungslose Kraft. Deshalb müssen wir aus einer Hoffnungslosigkeit uns zur Hoffnung verhalten. Die Hoffnung verurteilt uns zur Hoffnungslosigkeit. C) Das Verbot, »Lebenshoffnungen in der Brust zu hegen« (so, als wäre die Hoffnung nur dann erst Hoffnung, nur dann etwas, das gefährlich ist und das man deshalb verbieten muss, wenn es eben um eine »Lebenshoffnung« geht, um ein Ganzes, das ganze Leben) führt nicht zu einer Hoffnungslosigkeit im konventionellen Sinne, sondern hat Ruhe und Heiterkeit zur Folge. Erneut brauchen wir eine Hoffnungslosigkeit, ohne die es kein Verhältnis oder Nicht-Verhältnis zur Hoffnung geben kann, und sei es das negative oder privative Verhältnis des strengen, unnachgiebigen Verbots. Die Hoffnung schreibt uns einen Ort vor, den der Hoffnungslosigkeit, der hier der Ort von Ruhe und Heiterkeit sein soll.
In der Konstellation als Spannungsfeld der drei Begriffsaspekte, die eine Hoffnungslosigkeit als einzig mögliches Verhältnis oder Nicht-Verhältnis zur Hoffnung aufweist, erscheint die Hoffnung jedes Mal und jedes Mal auf unterschiedliche Weise als etwas, an das wir nicht rühren können und dürfen, das sich uns entzieht, das widerspenstig, eigensinnig, unfügsam ist, als eine Kraft, von der man nicht sagen kann, dass sie eine sinnvolle Kraft ist, eine für unser Leben sinnvolle Kraft, und die uns vorgibt, wo wir uns zu halten haben, wenn wir dieser Kraft nicht erliegen wollen, ja wenn wir sie überhaupt erfahren sollen, nämlich in der Hoffnungslosigkeit. Und das ist etwas, das sich zeigt, zeigen muss, nicht einfach etwas, das wir sagen, sagen können, eben in einer schlüssigen Begriffsentwicklung. Denn die bloße Rede von der Hoffnung, der Diskurs der Hoffnung, erweist sich gegenüber dem, was die Hoffnung wesentlich ist (eine wilde, unerträgliche, tödliche, unnahbare und zugleich zarte Kraft), als viel zu harmlos, als bloße »Versicherung« oder Beteuerung. Daher genügt der Diskurs der Hoffnung nie, selbst wenn man einen so eigentümlichen Satz wie den Satz Benjamins kommentiert. Eine Konstellation oder ein Spannungsfeld schaffen, auf eine selber kaum merkliche Art und Weise, nicht im Zuge einer wiederum diskursiven Ankündigung, einer Ankündigung, die die Konstellation wieder in den Diskurs einbezieht, heißt dann: die Hoffnung oder etwas an der Hoffnung muss sich zeigen, wenn sie uns überhaupt angehen – etwas angehen soll.
Auf dieser Gewalt und dieser Gewaltlosigkeit der Hoffnung, dieser Übertreibung, diesem Zuviel oder Zuwenig (denn »gegeben« ist sie uns ja nicht »für uns«, als könnten wir uns sie aneignen, uns auf sie berufen; »gegeben« bedeutet vielmehr: unberührbar, nicht erfassbar, nicht greifbar und nicht begreifbar) muss man insistieren, will man sich gegen einen Konformismus wehren, eine Ideologie der Hoffnung, die heute gängig sind, vor allem, wenn Politiker oder Kulturschaffende den Begriff verwenden, in einer Art widerlicher Frömmelei. Sie instrumentalisieren die Hoffnung, machen aus ihr eine Hoffnung auf X, konzipieren und identifizieren sie im Hinblick auf dieses X. Hoffnung ist von Anfang an eine bewältigte, domestizierte, normalisierte Kraft, ein Signal an sich und an alle anderen, dass man dabei ist, mitmacht: »Ich bin ein Träger der Demokratie, weil ich ein Hoffnungsträger bin mit einem Programm, auf mich könnt ihr setzen, mich könnt ihr wählen, ich werde euch nicht enttäuschen, und wenn doch, dann halt nur aufgrund der widrigen Umstände.« Nichts ist hoffnungsloser als die angeeignete Hoffnung. Sie hat jedes Verhältnis oder Nicht-Verhältnis zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit kassiert.
Hoffnung soll dazu dienen, etwas zu erreichen, einen Zweck, in dem sie sich erfüllt. Als Mittel zum Zweck oder als instrumentalisierte Hoffnung ist sie in einer eigentümlich aktiv-passiven Rolle, ohne die der Konformismus nicht funktioniert, der aus jeder Instrumentalisierung resultiert. Diese Aktivität und diese Passivität muss man lediglich radikalisieren, um auf eine andere Aktivität und Passivität der Hoffnung zu stoßen, die ihre Instrumentalisierung und den daraus resultierenden Konformismus durchkreuzt. Die »Bestie« Hoffnung, die in ihrer unbezähmbaren Unruhe höchst aktiv zu sein scheint, ist nämlich gleichzeitig die Hoffnung, die, indem sie uns rückhaltlos überfällt, sich so sehr exponiert, dass sie sich uns wiederum entzieht. Weil die Hoffnung in ihrer »Gegebenheit« immer mit einem Rückzug oder einem Entzug einhergeht, sogar und vor allem dann, wenn diese »Gegebenheit« als eine tätige vorgestellt wird, entwindet sie sich am Ende der Zweck-Mittel-Relation.
So kommt man auf ein Paradox, das man etwa an hoffnungsvollen, besonders zuversichtlichen Menschen erkennen kann. Es gibt eine Zuversicht, die sich an Inhalten orientiert und die dadurch gerade schnell etwas von einer »Versicherung« oder Beteuerung bekommt, egal, um welche Inhalte es sich handelt. Und es gibt eine Zuversicht, die sozusagen von Inhalten unabhängig ist, weil in ihr ein Überschuss zu stecken scheint. Hier bleibt die Hoffnung in dem Sinne unangetastet, selbständig und selbstlos, unerforschlich und unergründlich, unbeugsam und uns zugewendet, als die Zuversicht sich selbst rätselhaft bleibt, nicht eine begründete oder unbegründete Zuversicht ist. Das Paradox liegt darin, dass eine solche Zuversicht sich durchaus mit einer Hoffnungslosigkeit verträgt, etwa im Sinne der Ruhe und der Heiterkeit, von denen der Zögling in Walsers Roman spricht. Oder im Sinne eines ganz im Jetzt, in der Gegenwart Aufgehens, als könnte einem darin gerade nichts zustoßen, als wäre der Gedanke an etwas anderes, von außen Kommendes ein undenkbarer Gedanke. Oder im Sinne einer Hoffnungslosigkeit der Inhalte, eines sogenannten Schwarzsehens, das sich weigert, das Unerträgliche herunterzuspielen, das Unerträgliche der Hoffnung selber.
Alexander García Düttmann, 6.11.2021