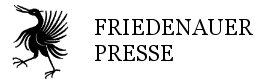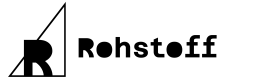Hin und wieder verschwindet der Krieg komplett aus dem schmalen Grenzland zwischen Tag und Nacht in Kiew, wenn kein unerwartetes Geräusch diese Zeit unterbricht. Es ist nicht allzu oft. Denn meistens ist der Krieg präsent, und es gibt kaum Auswege aus seiner Allgegenwart.
In den ersten Wochen des russischen Angriffs war ich noch davon überzeugt, dass das alles rasch, innerhalb weniger Stunden oder Tage beendet sein würde. Wie ein Gruß aus dieser Anfangszeit spüre ich die Angst nach jedem Luftalarm in mir aufsteigen.
Ich bin wieder in Kiew, nach einer langen Pause und wache morgens um halb vier wegen der lauten und dröhnenden Sirenen auf. Einige Minuten lang habe ich das Gefühl, die Warnung ernst nehmen zu müssen. Aber es ist eine in dieser Phase der Kriegsgewalt beinahe seltsame Idee, mitten in der Nacht in einen Schutzbunker zu gehen und zu versuchen, sich vor einer möglichen Gefahr in Sicherheit zu bringen. Ich lächle über meine eigene Unruhe, darüber, dass ich mir während meines Aufenthalts in Berlin abgewöhnt hatte, im Angesicht der Gefahr melancholisch und etwas fatalistisch den eigenen Routinen nachzugehen. Anstatt in den Bunker begebe ich mich müden Schrittes in die Küche und mache mir einen Tee. Der Luftalarm verstummt, und es legt sich eine nächtliche Stille über Kiew, die alle Gefahren zu verdrängen scheint.
Die heutigen Nachrichten in den Telegram-Kanälen der Städte Saporischschja, Charkiw und Mykolajiw warnen, dass die kommenden Tage besonders gefährlich sein sollen. Wir, die ukrainischen Leser, sollten uns in Acht nehmen. »Wir bitten Sie, wenn Sie die Warnsignale in den kommenden Tagen hören, wirklich in die Schutzbunker zu gehen« – die Nachrichten klingen, als ob der Schreiber mit jemandem streitet und mit immer neuen Argumenten versucht, widerspenstige Bürger zu überzeugen.
Um noch glaubwürdiger zu argumentieren, wurden wir benachrichtigt, dass beim Alarm ab heute neue Töne eingeführt werden. Für den Angriff mit chemischen Waffen werden die Kirchenglocken läuten, im Fall einer radioaktiven Gefahr läuten Sturmglocken.
Der Grund für diese Maßnahmen sind die wachsende Spannung an der Front und die kommenden Feiertage, vor allem der Unabhängigkeitstag am 24. August, der vor dem Krieg Anlass zu einer feierlichen Stimmung gab, die sich über Tage erstreckte. Heute sprechen die Menschen in Kiew über den kommenden Feiertag, aber viel weniger darüber, dass es auch eine Art Jubiläum ist, wenn der Krieg am Unabhängigkeitstag genau sechs Monate alt wird.
Je weiter man sich vom Krieg entfernt befindet, desto klarer werden die Zeitabläufe und man denkt, ein halbes Jahr Konflikt braucht einen besonderen Zugang, eine rationale Analyse oder eine Anamnese wie bei einer Krankheit, in der Hoffnung auf eine baldige Genesung.
Aber hier in Kiew zerfällt die Symbolik dieses runden Datums, weil sich die Menschen, die in den Krieg involviert sind – und das sind fast alle Ukrainerinnen und Ukrainer in der einen oder anderen Form –, keinen Abstand zum Krieg erlauben können.
Heute habe ich ein Kiewer Museum besucht, das gleichzeitig zu einem Ort geworden ist, wo Helfer ehrenamtlich Tarnnetze anfertigen. Jeden Tag kommen Frauen hierher, um auf festem Nylon kleine Stofflappen zu befestigen, einen Knoten nach dem anderen. Manchmal kommen auch die Kinder dieser Helferinnen und deren Freunde und arbeiten mit den Frauen zusammen. Man kann hier auch übernachten, in einer Eckr stehen Klappbetten und eine der Frauen zeigt mir auf ihrem Handy, wie ihre kleine Enkelin gemütlich auf einem Tarnnetz schläft. Ein zwölfjähriger Junge hat hier den Ruf, ein Virtuose des Knüpfens zu sein, weil er die Netze so schnell und meisterhaft zusammenband, dass andere ihn bewunderten.
Militärs aller Ränge und sämtlichen Frontrichtungen kommen hierher und hinterlassen ihre Bestellungen. Manchmal trinken sie Tee, genießen die Gesellschaft, erzählen und hören zu. Dann besuchen die Frauen die Frontlinie, um zu sehen, welche Netze besonders nachgefragt sind. In einem Nebenraum werden Medikamente für die Front gesammelt und sortiert.
Die Verwandte dieser Frauen, ihre Freunde, Männer und Brüder, ihre Schwestern und Töchter sind an der Front. Eine Bekannte von mir arbeitet hier, sie heißt Katerina und trifft an den Vormittagen zusätzlich als Kinderärztin Patientinnen in ihrer Praxis, die in der Nähe des Museums liegt. Jeden Tag, wenn sie ins Arbeitszimmer des Museums zu ihren Kolleginnen kommt, schaut sie in die Gesichter der anderen. Wenn sie keine Tränen und keine tiefe Verzweiflung in den Augen sieht, schließt sie daraus, dass es keine schreckliche Nachricht von der Front gibt und alle glücklicherweise noch am Leben sind.
»Manchmal denke ich«, sagt eine andere Helferin zu mir, »es wäre besser, wenn ich niemanden an der Front kennen würde. Jeden Tag gehe ich mit Todesangst schlafen, es gibt keinen ruhigen Morgen, keine ruhige Stunde in meinem Leben.«
Beim Abschied beginnt eine andere Näherin, Natalia, sich über die Kiewer zu beklagen: »Viele leben hier, als ob es keinen Krieg gäbe. Sie tun zu wenig, sie wollen vergessen, sie wollen sich ablenken und die ständige Todesgefahr ignorieren.« Die Bewohner von Charkiw im Osten des Landes würden dagegen klarer denken, glaubt sie. Vor Kurzem hat sie die Stadt besucht. »Alle in Charkiw wissen um den Tod, um die Gefahr, bleiben jedoch in der Stadt. Sie wollen alles retten, was zu retten ist.«
Sie habe während ihres Besuchs einen Raketenangriff erlebt und erzählt wie verträumt davon: »Ohne zu weinen, ohne zu fluchen und nach Schuldigen zu suchen, kommen nach dem Angriff die Sanitäter, die Nachbarn, die Rettungsdienste. Sie decken die Toten mit den Laken zu, bringen die Verletzten in Krankenhäuser und beginnen, die Trümmer zu durchsuchen.« Würden sie nicht täglich angegriffen werden, würden nicht immer neue Wohnhäuser zerbombt und Menschen ermordet – diese Leute hätten Charkiw längst wieder aufgebaut. So unglaublich tapfer und hilfsbereit seien die Menschen dort.
Je weiter man sich vom Krieg entfernt, höre ich immer wieder, desto leichter ist es zu denken, dass er niemanden so richtig betrifft.
Ein Bekannter von mir, ein Soldat, kam für zwei Wochen aus dem Donbass nach Kiew, um etwas Luft zu holen und zurück an die Front zu gehen. Vor dem Krieg arbeitete er als Programmierer und schrieb Lyrik. Er erzählte wenig. Ich dagegen erzählte ihm, dass meine Freunde in der Oblast Donezk in der kleinen Stadt Toretsk schon eine Woche keinen Strom haben und seit März kein Wasser mehr. Sie holen das Wasser seither aus den Brunnen. Die Stadt wollten sie längst verlassen, aber sie sind die einzigen, die humanitäre Hilfe bekommen und Nahrung und Medikamente an die übrigen Menschen verteilen können. Sie verschieben ihre Abreise von Tag zu Tag.
Die russischen Angriffe beginnen meistens nachts, in der schwarzen Dunkelheit. Dann zittert der Boden unter den Füßen, und die Leute fürchten, dass ihre kleinen Häuser mit den schmalen Kellern, in denen sie sich verstecken, jede Minute zerstört werden können. Unter den Beschüssen können sie kein Licht mehr anschalten, ihre Handys sind oft ausgeladen und sie müssen lange warten, bis sie vielleicht am nächsten Tag jemanden anrufen und sich überzeugen, dass ihre Freunde und Verwandte leben. Während ich das erzähle, nickt der Soldat mir verständnisvoll zu, er lebt seit Monaten umzingelt von Explosionen in einem Gefühl des unendlichen Bebens um ihn herum.
In den kleinen malerischen Dörfern säumen Ruinen die Straßen. Die Nächte werden wieder und wieder zu Einladungen für Verbrechen. Über den kommenden Winter spricht man in den Dörfern mit Zögern, auch weil Wasser- und Stromleitungen im ukrainischen Donbass zerstört sind.
Im Telegram-Kanal der Stadt Kiew lese ich über die Vorbereitungen von Russland, in den kommenden Tagen die zivile Infrastruktur anzugreifen, das Atomkraftwerk in Saporischschja ist in Gefahr. Wie vor einem halben Jahr warnt die amerikanische Botschaft die US-Bürger, sie sollten in diesen Tagen die Ukraine verlassen.
Iсh frage mich, wie kann es sein, dass das internationale Wissen über die neuen geplanten Verbrechen gegen Völkerrecht, Menschenrechte und die Umwelt nicht zu einer Möglichkeit führt, sie zu stoppen, sondern nur zu einem Vorwand für die Warnungen wird.
Meine Lieblingszeit in Kiew in diesen heißen Sommertagen ist das schmale Fenster zwischen dem Abend und der Nacht, die Übergangszeit, wo die Nachtluft durch die noch hellen Straßen strömt. Ich bin in Kiew und genieße in diesen Tagen jede Stunde, in der das Stadtleben mit seinen vielen alltäglichen Kleinigkeiten weiterläuft.
_______________
(Editorische Notiz: Dieser Text ist unter einem anderen Titel in leicht abgeänderter Fassung auf SPON erstveröffentlicht worden und dort weiterhin abrufbar.)
Am 13. Oktober erscheinen die gesammelten und um weitere Einträge ergänzten Kriegstagebücher aus Kiew von Yevgenia Belorusets unter dem Titel Anfang des Krieges bei Matthes & Seitz Berlin.