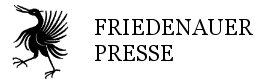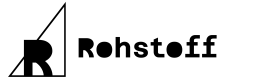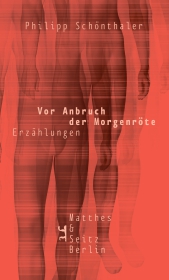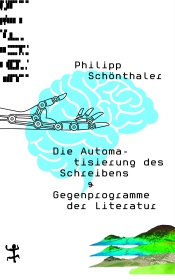Im Januar erscheint bei Matthes & Seitz Berlin das neue Buch von Philipp Schönthaler. Die Automatisierung des Schreibens & Gegenprogramme der Literatur erzählt davon, wie die industriellen Revolutionen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert – zunächst die Mechanisierung, dann die Automatisierung und schließlich die Digitalisierung – auch das literarische Schreiben erfassen. Autorinnen reagieren ganz unterschiedlich auf die Möglichkeiten und Herausforderungen der Technologie, die auch die seit der Romantik etablierte Koordinaten der Literatur infrage stellen. Erzählt aber wird noch heute. Mit der großen Studie setzt Schönthaler die 2017 mit dem Erzählband Vor Anbruch der Morgenröte begonnene Auseinandersetzung mit der digitalen Technik fort. In der Reihe »Leben und Dienste« ist auch sein letzter Roman Der Weg aller Wellen (2019) erschienen.
Matthes & Seitz Berlin: Zuletzt hat sich Daniel Kehlmann daran versucht, einer künstlichen Intelligenz das Romanschreiben beizubringen. In Mein Algorithmus und ich (2021) berichtet er von seinem Scheitern. Den Beruf der Romanautorin wenigstens, so scheint es, ersetzen die Maschinen noch nicht. Was hat dich an der Geschichte der Automatisierung des (literarischen) Schreibens gereizt?
Philipp Schönthaler: Ich habe mich gefragt, was daraus folgt, dass digitalen Datenströme in wesentlichen Belangen ausmachen, was die Welt heute im Inneresten zusammenhält. Inwiefern berührt diese neue Ordnung des Digitalen, die den globalen Finanztransaktionen genauso wie den Sozialen Medien zugrunde liegt, das literarische Schreiben? Genügt es, über die digitalen Technologien wie über andere Themen zu schreiben, oder reicht das literarische Schreiben gar nicht mehr an die Logik des Digitalen und der Algorithmen heran?
Greifbar wurde diese Frage für mich allerdings erst über den Rückbezug auf die Avantgarden der 1910er- und 20er-Jahre. Sie nutzten die Technomedien ihrer Zeit offensiv, um sich von der klassischen Literatur und deren Schreibweisen abzunabeln. Die Avantgarden haben meinen Blick dafür geschärft, wie das Schreiben selbst in einem emphatischen Sinn als Technik zu begreifen ist. Außerdem machen sie deutlich, dass die Frage, wie man schreiben soll, immer auch an kulturelle Zuschreibungen und poetische Überzeugungen gebunden ist, und sich nicht ausgehend von einem bestimmten Stand der Technologie, also dem, was möglich ist, adressieren lässt.
Daniel Kehlmann ist in diesem Kontext dennoch ein gutes Beispiel. An ihm wird deutlich, dass die KI mittlerweile nicht nur als Thema, sondern mehr noch als Herausforderung für das Schreiben im Mainstream der Literatur angekommen ist. Die Programmierung ist nicht mehr – wie noch in den 1960er-Jahren – automatisch im Bereich der experimentellen oder avantgardistischen Literatur angesiedelt. Umgekehrt, und das ist vielleicht noch entscheidender, beschäftigten sich mittlerweile die großen IT-Konzerne und viele Start-ups mit der computerbasierten Generierung von experimentellen und konventionellen Texten. Die Sprache gilt als besondere Hürde hin zur Entwicklung einer allgemeinen KI. Hinzu kommen konkrete Anwendungen wie die automatische Generierung von Medieninhalten, aber auch als Interface wird die Sprache wichtiger, um die Interaktionen zwischen Menschen und Computern, die zunehmend in Objekte und die Umwelt integriert werden, zu steuern. Ich versuche sowohl der Bedeutung der computerbasierten Sprachverarbeitung für die Literatur als auch für die Gesellschaft insgesamt Rechnung zu tragen.
MSB: Eine zentrale Rolle nehmen in deiner Studie die Nachkriegsliteraturen ein. Nahliegend ist das bei der Stuttgarter Gruppe um Max Bense mit ihrer Vorstellung einer rationalen Ästhetik oder den Anfängen der Computerkunst, die zeitgleich in Amerika im Rahmen dessen entstehen, was man heute den militärisch-industriellen Komplex nennt. Für mich zunächst überraschend werden aber die Wiener Gruppe, insbesondere Oswald Wiener und Konrad Bayer, sowie Samuel Beckett und Georges Perec – also das, was man ganz klassisch Nachkriegsavantgarden nennen könnte – zu den zentralen Protagonisten deiner Erzählung. Wie kommt das?
PS: Die historischen Avantgarden bilden für mich letztlich die Folie, vor der sichtbar wird, unter welchen Vorzeichen der Computer in den 1950er- und 60er-Jahren überhaupt für die Literatur entdeckt und attraktiv werden kann. Computer sind damals noch raumfüllende Apparaturen, die irrsinnig teuer und nicht für einen Privatgebrauch vorgesehen sind. Bedient werden sie von einer exklusiven Riege von Ingenieuren, die die nötigen Fachkenntnisse besitzen. Außerdem müssen sie erst von militärischen in kommerzielle Maschinen umcodiert werden. Wenn ich mir Zeit nehme, um zu beschreiben, wie der Computer für die Literatur entdeckt wird, dann deshalb, weil es einer immensen Deutungsarbeit bedarf, um ihn theoretisch kompatibel mit dem literarischen Schreiben zu machen. Zugleich bedient die Vorstellung der Rechenmaschine aber offenkundig Hoffnungen und Bedürfnisse, die gerade in der Nachkriegszeit auch in der Literatur virulent sind. So ist es zugleich unwahrscheinlich und schlüssig, dass jemand wie der ausgebildete Physiker Max Bense, der selbst übrigens nie gelernt hat, einen Computer zu bedienen, in den 1960er-Jahren im Computer – oder genauer: im abstrakten Prinzip des Computers – das ideale Mittel sieht, um die Literatur zu revolutionieren.
Am wichtigsten ist daher vielleicht, dass die von dir genannten Autoren besonders früh auf Entwicklungen reagieren, die wir im Rückblick als wichtige Scheidepunkte auf dem Weg zur Digitalisierung beschreiben können. Anders als Kehlmann experimentieren sie nicht mit der Programmierbarkeit des Schreibens, um dann zum Schluss zu kommen, dass die Computer gar nicht einlösen können, was sie scheinbar versprechen, also etwa einen guten Roman zu schreiben – in dieser Hinsicht hat sich zwischen damals und heute wenig geändert. Stattdessen integrieren sie formalsprachliche Kalküle, die die Basis der Programmierung bilden, in ihre Texte. Einerseits zeigen sie so, dass die Programmierbarkeit eine inhärente Eigenschaft der Schrift ist, was übrigens auch heißt, dass sie zum Beispiel bestimmten Formen des Denkens wie der Logik zugrunde liegt. Das bedeutet aber andererseits nicht, dass sich die natürliche Sprache pauschal automatisieren ließe, oder dass das Schreiben seine Bestimmung fortan in der Programmierung finden soll. Die Autoren entwickeln bewusst was ich nichtprogrammierbare Schreibweisen nenne und lassen darin die Grenzen der Umwandlungsprozesse oder auch den Preis, den man für sie zahlt, sichtbar werden.
Zentral sind die genannten Autoren für meine Arbeit, weil sie ein meines Erachtens noch immer gültiges Problembewusstsein artikulieren. Ihre Lektion ließe sich so zusammenfassen: Man muss das Schreiben auf der Grundlage der Programmierung, und zugleich die Programmierung auf der Grundlage des Schreibens betrachten, sodass sich beide gegenseitig erhellen. Sie buchstabieren so in ihren Arbeiten bereits zu diesem frühen Zeitpunkt aus, was es heißt, im Zeitalter des Digitalen zu schreiben, sofern man sich bewusst auf die technologischen Bedingungen einlässt.
MSB: Die Frage »schreiben oder programmieren« gewinnt auch im Fortgang deiner Arbeit zunehmend an Gewicht. Eine scharfe Trennlinie ist, wie du sagst, zwischen beidem nicht immer zu ziehen. Zugleich aber machst du stark, dass mit der Entscheidung für das eine oder das andere grundsätzlich andere Vorstellungen von Welt und Subjekt einhergehen.
PS: Die Begriffe Sprache, Schrift oder Code sind in ihrem Gebrauch schwammig. Beispielsweise sprechen wir von Programmiersprachen, dabei ließe sich mit gutem Recht einwenden, dass es sich beim Computercode um gar keine Sprache handelt, weil ihm sowohl die semantische als auch die pragmatische Dimension fehlt, die natürliche Sprachen auszeichnet. Ich lege mein Augenmerk deshalb darauf, wie in Konstellationen Schreiben und Programmieren jeweils in ein spezifisches Verhältnis zueinander gesetzt werden, sich dabei einerseits gegenseitig bedingen, andererseits aber eben nicht einfach ineinander aufgehen.
Mein Vergleichsterm ist hierbei die Verknüpfung. Meine These ist, dass Schreiben und Programmieren zwei unterschiedliche Techniken der Verknüpfung darstellen. Geht man vom Schreiben und Programmieren als zwei Verkettungstechniken aus, liegt ein offensichtlicher Unterschied in Bezug auf die Sprache darin, dass die Programmierung nur syntaktische Verknüpfungen verarbeiten kann. Die natürliche Sprache kann aufgrund ihrer semantischen Dimension dagegen von sich selbst sprechen, ohne die Sprache zu wechseln.
Das mag sich banal anhören, hat aber weitreichende Folgen, weil ich Aussagen, die Entscheidungen und die Wissensproduktion, die ich im Medium der natürlichen Sprache entwickle, problematisieren oder zur Disposition stellen kann. Jean-François Lyotard schreibt den in dieser Hinsicht einprägsamen Satz, »dass die Verkettung von Sätzen problematisch und eben dieses Problem die Politik ist«. Worte und Sätze zu verknüpfen ist also kein simples oder unschuldiges Geschäft. In der Programmierung droht das aber verloren zu gehen beziehungsweise unsichtbar zu werden. Algorithmen stellen die Lösung auf ein spezifisches Problem dar. Damit der Prozess der Textgenerierung automatisiert werden kann, müssen die Prinzipien, wie Worte und Sätze verknüpft werden, vorab festgelegt werden. Nur so kann sie der Computer nach einem einheitlichen Schema abarbeiten. Die Parameter der Entscheidungen, wie Verknüpfungen hergestellt werden, sind mit der Wahl eines Programms also immer schon gefällt.
Die These, dass Schreiben und Programmieren an zwei unterschiedliche Vorstellungen von Subjektivität und der Erschließung von Welt gebunden sind, setzt sich dann letztlich aus einer ganzen Reihe einzelner Faktoren zusammen. Diese sind im Schreiben und der Programmierung als spezifischen Techniken angelegt, die komplex sind. Hier kommen außerdem kulturelle Zuschreibungen ins Spiel. So geht die Informatik typischerweise von einem verhaltensbasierten Subjekt aus, das sich kaum mit der Vorstellung des Menschen als zur Sprache befähigtem Tier verträgt. Insgesamt hilft es glaube ich nur, genau hinzuschauen, und die vielen, auch kleinen Differenzen stark zu machen, die sich gemeinsam aufaddieren. Das führt weniger zu bündigen Antworten, zeigt aber, dass das Schreiben als Technik das Denken in andere Bahnen lenkt und beispielsweise auch zu einer anderen Vorstellung führt, was Denken und Schreiben überhaupt sein könnten, als es der Fall wäre, wenn ich bei der Programmierung ansetze und ausgehend von der Logik des Programmierens danach frage, was Denken und Schreiben sind. Ähnliches gilt für die Beziehung des Menschen zur Gesellschaft oder Natur: Auf der Grundlage der Programmierung werden sich diese Beziehungen anders gestalten und sie werden andere Vorstellungen stiften als auf der Grundlage des Schreibens.
MSB: In der zweiten Hälfte löst sich deine Studie dann auch zunehmend von der Literatur im engeren Sinne. Du widmest dich der Rolle der Kybernetik als eines technologischen Regierungsdenkens, setzt dich mit der Start-up-Kultur des Silicon Valley (in das auch Kehlmann für seinen KI-Versuch geflogen ist) auseinander, und landest schließlich sogar beim Terraforming, das von einigen derzeit als Antwort auf den Klimawandel propagiert wird. Inwiefern ist deine Auseinandersetzung mit der Literaturgeschichte hier nützlich, um einen neuen Blick auf diese Gegenstände zu gewinnen, die ja diskutiert – und auch umkämpft sind?
PS: Möglicherweise überspanne ich den Bogen (lacht). Dennoch denke ich, dass die ausgreifende Perspektive gerechtfertigt oder sogar nötig ist. In gewisser Weise liegt das Grenzüberschreitende schon in der Sache. Mit der Frage nach dem Schreiben ist ja auch ein Ordnungssystem aufgerufen, das zum Kern menschlicher Zivilisationen gehört. Nicht zufällig wählten die Googlegründer Larry Page und Sergey Brin für ihre neue Muttergesellschaft für Google den Namen Alphabet. In ihrer Begründung schreiben sie, dass das Alphabet zu den größten Erfindungen der Menschheit gehöre. Mit ihrer Firma, so darf man folgern, erheben sie nun den Anspruch, über das neue digitale Alphabet, den digitalen Code, verfügen zu wollen. Einerseits liegt es also im Thema der Sprache und des Schreibens, dass meine Studie ihre Grenzen von innen sprengt. Andererseits gibt es aber eine – wie ich es von der Literatur herkommend formulieren würde – Zumutung, die eher äußerlich ist. Sie artikuliert sich in einem bestimmten Auftreten wie es exemplarisch bei Google der Fall ist: Zu beanspruchen, als Unternehmen über das Weltwissen verfügen zu können, die Vorstellung, dass seine Algorithmen mich besser kennen, als ich mich selbst, oder dass sich eben auch das Romanschreiben oder Kunstmachen vollständig automatisieren ließen – und dabei nichts verloren ginge. Aus dieser Perspektive sind es also die hegemonialen Ansprüche des technologischen Wandels und wie sie über technokapitalistische Dynamiken durchgesetzt werden, die es meiner Meinung nach notwendig machen, zu reagieren.
Die Literatur hat hier etwas Eigenständiges zu sagen. Ein Ausgangspunkt des letzten Teils meiner Studie liegt darin, dass die Technowissenschaften auf fundamentale Weise auf Erzählungen angewiesen sind. Offensichtlich vollzieht sich das im unternehmerischen Storytelling. Es zeigt sich aber auch in der Rolle der Science-Fiction für die technologischen Entwicklungen. Man muss das Literarische also nicht an die Digitalökonomie herantragen, es ist bereits in ihrem Kern wirksam. Wo erzählt wird, kann die Literatur aber mitreden. Zumal sie von einer Tradition und einem Wissen zehren kann, das weit über das informatische Denken und seine Welt-, Gesellschafts- und Subjektentwürfe hinausreicht.
MSB: Mein Eindruck ist, dass sich Auseinandersetzungen um das (literarische) Schreiben und seine sozialen, ökonomischen und technischen Bedingungen aktuell häufen. Wieso, glaubst du, gibt es dieses neuerliche Interesse? Steht dein Buch auch in diesem Kontext?
PS: Das scheint mir eine gute Beobachtung sein. Ich vermute schon, dass das auch wesentlich mit der Digitalisierung zu tun hat, die einerseits basale Gewissheiten erschüttert, andererseits aber eben auch den Blick frei dafür machen kann, bestimmte Phänomene wie das Schreiben, das auch in seiner Alltäglichkeit und Allgegenwart schwer zu fassen ist, aus seiner scheinbaren Selbstverständlichkeit herauszulösen und neu zu betrachten.
Man könnte natürlich fragen, warum das jetzt geschieht. Ein Grund wäre, dass die Geschichte der Digitalisierung von zahlreichen Ungleichzeitigkeiten geprägt ist. Gut zeigt sich das im Medienumbruch der 1960er- und 70er-Jahre. Einerseits wird das Aufkommen der elektronischen Medien emphatisch theoretisiert und findet einen breiten Niederschlag. Marshall McLuhan spricht vom Ende der Printkultur; Gilles Deleuze und Félix Guattari behaupten, dass die Sprache als linguistisches Zeichensystem ein Gefängnis sei, dem man sich durch asignifikante Schreibweisen entwinden müsse, was ihr Schreiben in die Nähe zu Signaltheorien rückt, wie sie in der Informationstheorie und Kybernetik zirkulieren. Andererseits ist es aber eine Zeit, in der das Buch eine ungeheure auratische Aufladung erfährt; Schriften wie die von Deleuze und Guattari, die den Sinn hinter sich lassen wollen, werden – was nicht frei von Ironie ist – in Lesezirkeln unter großen Mühen hermeneutisch entziffert.
Mittlerweile wird glaube ich ein viel differenzierter Blick auf das Verhältnis von der Print- und Schrift- zur Digitalkultur geworfen. Einerseits führt die Digitalisierung dazu, dass die tradierten Medien und Praxen neu entdeckt werden. Andererseits verläuft die Digitalisierung aber in vielen Belangen viel schleppender und uneinheitlicher, als es die Reden vom Ende des Buchs, des Romans oder des Subjekts hinausposaunt haben. Es ist, denke ich, kein Zufall, dass der Onlineversandhandelsgigant Amazon, der mittlerweile auch im Streaming-Geschäft, Smart-Devices, Crowd- und Clickwork, digitalen Dienstleistungen und so weiter unterwegs ist, im Handel mit konventionellen, gedruckten Büchern begonnen hat. Wenn es über den Medienumbruch hinweg außerdem viele Kontinuitäten gibt, dann liegt das meines Erachtens auch daran, dass die Ökonomie oft schwerer für die Entwicklung des Schreibens und der Literatur als die Medien selbst wirken. Oder anders formuliert: Spezifische Medien gewinnen ihren Einfluss erst auf der Basis von und im Verhältnis zu bestimmten ökonomischen Strukturen. Das heißt auch, dass hier kein einfacher Mediendeterminismus wirkt. Die Frage, ob das Buch erhalten bleibt, oder welchen Stellenwert digitale Medien einnehmen, leitet sich aus keiner Überlegenheit des einen Mediums über das andere ab, sondern hängt von ökonomischen, sozialen und politischen Faktoren, aber auch von institutionellen Weichenstellungen ab.
MSB: Zum Abschluss und weil wir mit Daniel Kehlmann und seinem Experiment mit der KI angefangen haben. Du bist selbst Schriftsteller und hast dich in deinen literarischen Arbeiten bereits auf ganz verschiedene Arten und Weisen mit der digitalen Technologie auseinandergesetzt, mit einer smarten Mikrowelle beispielsweise, die auf einmal nicht mehr tut, was sie soll. Dabei greifst du einerseits auf Formen traditionellen realistischen Erzählens zurück, bedienst dich aber auch der Mittel, die modernistische und postmoderne Literaturen bereitgestellt haben. Jetzt hast du eine Studie zum Verhältnis von Schreiben und Automatisierung geschrieben. Folgt aus deiner neuerlichen theoretischen Auseinandersetzung auch etwas für deine eigene Literatur?
PS: Es hat schon auch als Selbstvergewisserung begonnen, ob man heute, zumindest aus einer avantgardistischen Perspektive, nicht eher programmieren statt literarisch schreiben sollte. Zwischendurch habe ich gedacht, dass ich zu einer vermittelnden Perspektive finde, die das Schreiben und Programmieren als zwei gleichwertige Zugänge zur Schrift und Welt darstellt. Merkwürdigerweise herrscht noch immer ein tiefer Graben zwischen Autorinnen, die der natürlichen Sprache verpflichtet sind, und Autorinnen, die die Programmiersprache primär setzen. Gerade, wenn man sich mit der Digitalisierung ernsthaft beschäftigen will, bleibt die natürliche Sprache unverzichtbar. Dass man sich mit der Digitalisierung aber auch als Schriftstellerin beschäftigen muss, scheint mir offenkundiger denn je.
Das Gespräch führten Morten Paul (Lektorat) und Philipp Schönthaler im 2021.
Foto-Copyright: Julia von Vietinghoff